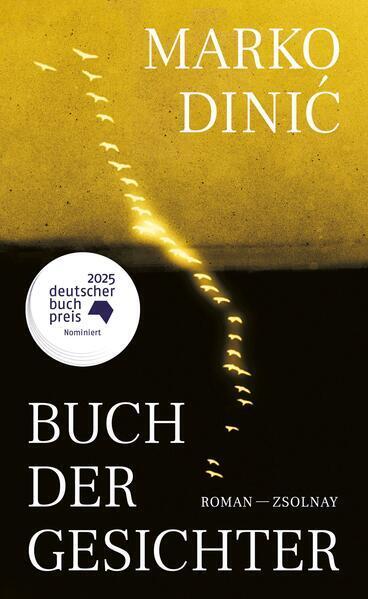Dann leben auch andere
Stefanie Panzenböck in FALTER 35/2025 vom 27.08.2025 (S. 29)
Der Hinweis ist hilfreich. "Es ist, wie Sie sehen werden, ein Roman mit einem etwas eigenwilligen Aufbau", zitiert Marko Dinić zu Beginn seines Buches den Schriftsteller Leo Perutz. "Buch der Gesichter" ist in acht Kapitel unterteilt, die nicht chronologisch angeordnet sind. Sie stellen die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven dar und funktionieren, wie angekündigt, als "selbstständige Erzählungen". Am Ende hat man einen packenden Roman gelesen, der zeigt, wie Nachgeborene an die Schrecken der Geschichte erinnern können und was diese mit der Gegenwart tun haben.
Dinić, 1988 in Wien geboren, verbrachte seine Kindheit und Jugend in Belgrad. Später studierte er in Salzburg Germanistik und jüdische Kulturgeschichte. Mittlerweile lebt der Autor in seiner Geburtsstadt. "Buch der Gesichter" ist nach "Die guten Tage" sein zweiter Roman und für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Es geht um die jüdische Gemeinde in Zemun bei Belgrad, an deren Beispiel Dinić von der Verfolgung und Vernichtung der Juden in Serbien erzählt. Das Buch berichtet von Konzentrationslagern, dem Lastwagen, der durch Belgrad fuhr und in dessen Innenraum tausende Jüdinnen und Juden vergast wurden, und von den Schiffen, die von Bratislava aus ans Schwarze Meer und von da nach Palästina wollten, aber über Serbien nicht hinauskamen. An Bord befanden sich 1100 Jüdinnen und Juden, von denen die meisten ermordet wurden.
Als Protagonist fungiert der 1910 geborene Isak Ras, mit dem das Buch beginnt. Seine Mutter Olga und er leben in Zemun in ärmlichen Verhältnissen. Als Juden sind sie dem Argwohn, meistens aber der Hetze ihrer Mitbürger ausgesetzt. In einer Schlüsselszene beobachtet Isak seine Mutter, wie sie die Haggada, ein wichtiges Buch im Judentum, das religiöse Texte, Lieder und Handlungsanweisungen für den Seder-Abend vor dem Pessachfest enthält, im Haus vergräbt. Kurze Zeit später, im Jänner des Jahres 1921, ist Olga plötzlich verschwunden. Niemand scheint zu wissen, was mit ihr passiert ist. Dinić hält die Spannung bis zum Schluss.
Im ersten Drittel des Romans hängen sprachlich einige Bilder schief: "Der Freudentaumel war vorher schon in Wahn gegossen worden." Oder: "Auf ihrem Rücken trug sie die Abenddämmerung, mit deren jähem Einbruch sich die Menge zerstreute."
Doch die Metaphern werden mit der Zeit weniger, der Text dadurch klarer und stärker.
Am 6. April 1941 überfiel das nationalsozialistische Deutschland Jugoslawien. Belgrad wurde schwer bombardiert, Serbien blieb bis zum Herbst 1944 besetzt.
Die Erzählung kehrt innerhalb der Kapitel immer wieder an einen Tag im Juni 1942 zurück. Da meldete der zuständige SS-Standartenführer nach Berlin, dass Serbien nun "judenfrei" sei. Dinić lässt seine Protagonisten diesen Tag schildern. Isak irrt durch Belgrad auf der Suche nach den Spuren seiner Kindheit: "Vielleicht war er der einzige freie Jude in Beograd, und wenn er lebte, würden auch andere Juden leben." Isaks Zieheltern, die Anarchisten Rosa und Milan, die ihn nach dem Verschwinden der Mutter bei sich aufgenommen haben, kommen zu Wort, der Partisane Petar, die Hündin Malka und der Beamte Mirko, der den Nachnamen des Autors trägt.
Dinić insinuiert, dass seine Familie Teil dieser Geschichte ist. Ein Brief eines Verwandten, der 1988, wenige Jahre vor Beginn der Jugoslawienkriege, ein schreckliches Familiengeheimnis aufdeckt, soll als Vorlage für "Buch der Gesichter" gedient haben.
Ob das wahr ist, tut nichts zur Sache. Dinić spielt gekonnt mit dem Bedürfnis der Leserschaft nach Authentizität. Doch viel wichtiger ist: Er zeigt mit dem Roman und besonders mit den scheinbar persönlich konnotierten Passagen, wie Erinnerung nach dem Tod der Zeitzeugen möglich ist und literarisch fortleben kann.