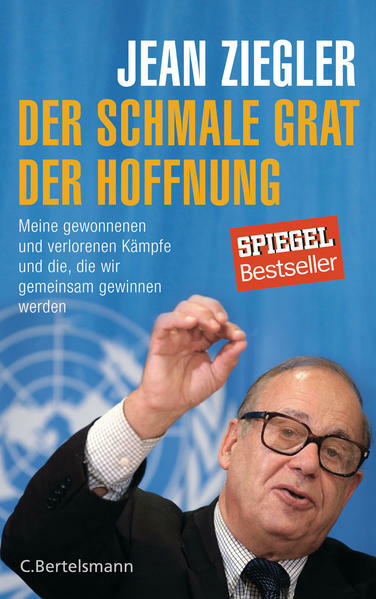Ein Prediger für die Macht des Gewissens
Wolfgang Zwander in FALTER 26/2017 vom 30.06.2017 (S. 23)
Unbequeme Wahrheiten werden gerne verdrängt. Jean Ziegler verkauft seit Jahren seine Bücher über Not und Elend. Wie gelingt ihm das?
Wer Jean Ziegler trifft, um ein Gespräch mit ihm zu führen, wird womöglich enttäuscht. Der Schweizer Professor, Menschenrechtsaktivist und Bestsellerautor lässt sich zumeist nur ungern auf einen Dialog ein. Vielmehr predigt er.
Ziegler sitzt in einem Hinterzimmer im Wiener Hotel Triest und empfängt wie am Fließband Journalisten, die sich mit ihm über sein neues Buch „Der schmale Grat der Hoffnung“ unterhalten wollen. Das Werk erzählt das Leben des Autors und handelt im Wesentlichen von den gleichen Themen wie Zieglers andere Bücher, darunter etwa „Der Aufstand des Gewissens“, „Der Hass auf den Westen“ und „Die neuen Herrscher der Welt“. Sein neues Werk wird sich wieder prächtig verkaufen, denn der Prediger Jean Ziegler hat mittlerweile weltweit hunderttausende Anhänger und Sympathisanten.
Der 83-jährige Schweizer ist ein Phänomen unserer Zeit, ein intellektueller Popstar, der mit seinen Vorträgen Hörsäle füllt. Seit nunmehr Jahrzehnten kritisiert er die globale Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die „kannibalische Weltordnung“, wie er sie nennt. Darunter versteht er zum Beispiel, dass die 85 reichsten Milliardäre der Welt laut Studien so viele Vermögenswerte haben wie die 4,5 Milliarden ärmsten Menschen auf unserem Planeten. Und dass alle fünf Sekunden ein Kind an den Folgen von menschengemachtem Hunger stirbt – obwohl es heute überhaupt keinen objektiven Grund mehr für dieses Elend gebe.
Ziegler hat sich einmal einen „weißen Neger“ genannt. Also einen privilegierten Weißen, der auf der Seite der Notleidenden und Ausgeschlossenen steht. Mit seinen Worten und Werken möchte er, zumindest für einen Moment, die Verdrängung des Leids in den Entwicklungsländern aufheben, die Entfremdung von entfernten Realitäten beenden und verstörende Wirklichkeiten in die Wohnzimmer der Mittelschicht bringen.
Aus Hans wurde Jean
Unbequeme Wahrheiten werden oft und gerne verdrängt, doch der Schweizer Professor weckt das Interesse an einer Auseinandersetzung mit ihnen. Wer verstehen will, wie er das macht, muss den Menschen Jean Ziegler und sein außergewöhnliches Leben voller Widersprüche näher betrachten.
Der Erfolgsautor wuchs in einem der reichsten Länder der Welt auf, als Sohn eines Richters und Obersts der Schweizer Armee. Ihm war ein Leben in Wohlstand in die Wiege gelegt, das er als Jugendlicher aber als „Gefängnis aus Beton“ empfand.
Mit 18 Jahren zog es ihn nach Paris, er studierte Rechtswissenschaften und Soziologie und lernte über die Kommunistische Partei den Philosophen Jean-Paul Sartre und dessen Gefährtin Simone de Beauvoir kennen. Damals stellte er sich noch als „Hans Ziegler“ vor, doch Beauvoir riet ihm, er solle sich besser „Jean“ nennen, denn „Hans“ klinge furchtbar.
Mit dem neuen Namen begann ein neues Leben. Er verschlang marxistische Klassiker, studierte Hegel, Kant und Rousseau und saugte Werke über die Französische Revolution geradezu in sich auf. Das taten damals viele Studierende, doch im Unterschied zu ihnen ist Ziegler seinen Idealen aus der 1968er-Bewegung weitestgehend treu geblieben.
Er träumte schon in diesen Jahren von der Weltrevolution, doch niemand Geringerer als die Revolutionsikone Che Guevara empfahl ihm bei einem Besuch in Genf, er solle seinen Kampf für eine bessere Welt von der Schweiz aus führen.
Bürgerliche Karriere im Widerstand
Auf dem Papier legte Ziegler daraufhin eine bürgerliche Karriere hin; er ging zur Uno, nahm an internationalen Missionen in Krisengebieten teil und wurde UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, er wurde Abgeordneter für die Schweizer Sozialdemokraten im Parlament in Bern und Professor an der Universität Genf sowie an der Sorbonne in Paris.
Sein Weg durch die Institutionen änderte aber nichts an der Schärfe seiner Kritik: an Spekulationen auf Nahrung, an der Privatisierung öffentlicher Güter, kurzum an der unbegrenzten Macht des Kapitals. Sein beruflicher Werdegang verlieh seinen mitunter radikalen Thesen Legitimation und wachsendes Gehör. Seine Streitbarkeit verschaffte ihm Anhänger wie Feinde. Die Schweiz nannte er ein „von der Bankenoligarchie kolonialisiertes Land“, ihn nannte man dafür einen „Landesverräter“. Seine Gegner verklagten ihn und trieben ihn mehrfach an den Rand des Ruins. Ein finanzielles Opfer, das seine Glaubwürdigkeit nur noch verstärkte und die Aufmerksamkeit für seine Mission erhöhte.
Ziegler predigte einfach unbeirrt weiter, dass wir die scheinbare Unveränderbarkeit unserer Weltordnung nicht akzeptieren dürfen. Die Schilderung unmenschlichster Missstände verband er immer lauter mit einem Appell an die Menschlichkeit – und gegen die Verdrängung und das Wegsehen.
Vermutlich erklärt auch das seinen Erfolg: Ziegler zeigt keine konkreten oder gar technischen Möglichkeiten auf, wie sich die „kannibalische“ Weltordnung beseitigen ließe. Aber er gibt seinen Lesern und Zuhörern die Hoffnung, dass die Zivilgesellschaft politisch nicht zur Ohnmacht verdammt ist. „In einer Demokratie gibt es keine Ohnmacht“, wiederholt er seit Jahren wieder und immer wieder. Und für ihn gibt es in dieser Frage schon lange nichts mehr zu diskutieren, die Fakten liegen seiner Meinung nach auf dem Tisch. „Ich hasse Dialog“, sagte er einmal in einem Interview. Gegen Ende des Treffens im Hotel Triest zitiert Ziegler zustimmend Papst Franziskus. Es gebe eine neue Kategorie von Menschen auf der Welt, die Ausgeschlossenen, die wie Abfall behandelt würden. Nach dem Papst-Zitat beendete Ziegler schließlich das Gespräch mit den Worten: „Das müssen wir ändern. Amen, liebe Gemeinde.“