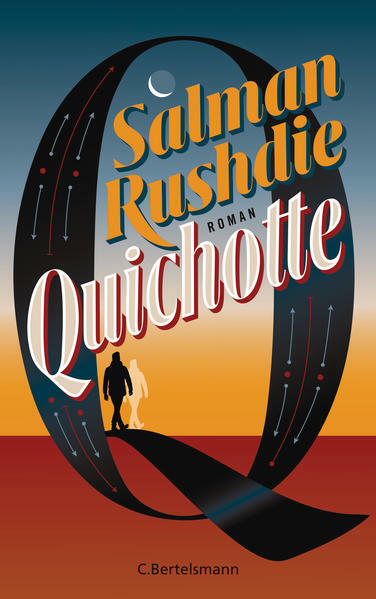Der Rest wird gegoogelt
Stefan Löffler in FALTER 45/2019 vom 06.11.2019 (S. 41)
In „Quichotte“ beamt Salman Rushdie Cervantes ins Trumperica der Gegenwart und lässt zu viele Puppen tanzen
Salman Rushdie ist ein Meister der literarischen Völlerei. Von Roman zu Roman werden seine Erzählwerke üppiger und ausschweifender. Alles, was er über sich und die Welt weiß, was er seit dem vorangegangenen Roman erlebt, gelesen und erfahren und in den Kunst- und Unterhaltungswelten konsumiert hat – alles muss im Roman aufgetischt werden. Der Rest wird gegoogelt.
In „Quichotte“, seinem jüngsten, 14. Roman, hat Rushdie erneut ein bombastisches literarisches Büffet angerichtet, überladen mit Anleihen aus der Weltliteratur und der eigenen Biografie und überdekoriert mit stilistischen Finten wie etwa changierenden Handlungsebenen und metafiktionalen Doppel- und Dreifach-Plots. Zum Drüberstreuen gibt’s allerhand magischen Schnickschnack und dazu Rushdies beliebteste Gewürzmischung – Namedropping von Promis, immer ganz nah an der Tagesaktualität, von Oprah Winfrey bis Elon Musk. Ist man als Leser danach gesättigt oder hat man Rushdies literarische Orgie fürs Erste eher satt? Das ist die Frage.
Der Romantitel verweist auf den Grundeinfall: Rushdie hat sich vom „Don Quijote“ des Miguel de Cervantes, dem ersten modernen Roman der Weltliteratur, inspirieren lassen und ihn sehr frei für heute adaptiert. Er nennt seinen Helden „Quichotte“ wie in Jules Massenets Oper, vor allem aber um eines Kalauers willen. Quichotte klingt im Englischen wie „key shot“ – jene Menge von Meth, Koks oder Heroin, die man von einem Schlüssel wegschnupfen kann. Denn Rauschmittelsucht in allen möglichen Spiel- und Betäubungsarten ist ein Hauptthema des Romans, von Drogen- und Schmerzmittelmissbrauch – Stichwort: Fentanyl-Krise in den USA – bis zu Liebesobsession, TV-Junk- und Internetbesessenheit und Surfsucht in virtuellen Welten.
Rushdies Quichotte ist ein ältlicher und altmodischer US-Einwanderer indischer Herkunft, ein bescheidener Pharma-Vertreter, der bis zum Hirnschaden süchtig wird nach der „unwirklichen Wirklichkeit“ des Trash-Fernsehens, ähnlich wie das Cervantes-Original durch die übermäßige Lektüre alter Ritterromane närrisch wurde. Rushdies Held verliebt sich auf dem Bildschirm in eine moderne Dulcinea-Variante, eine US-Talkshow-Queen gleichfalls indischer Herkunft. Mit feinsinnigem Witz verpasst ihr Salman Rushdie den Namen Salma R.
Der liebesverrückte Quichotte begibt sich in der Folge auf eine Quest, eine ritterliche Läuterungswallfahrt, um sich der Liebe seiner Herzensdame würdig zu erweisen. Auf seiner pikaresken Reise quer durch Amerika wird er von Sancho begleitet, seinem erträumten Sohn, einer reinen Kopfgeburt, die er aus dem Nichts herbeifantasiert. Doch Sancho möchte bald auf eigene Faust losziehen, auf Pinocchio-Art: Er möchte ein richtiger Mensch werden, mithilfe einer sprechenden Zaubergrille, die Jiminy Cricket heißt, wie sonst.
Unterwegs erleben Vater und Sohn alle möglichen, meist unliebsamen Abenteuer, oft Zusammenstöße mit rassistischen Dumpfbacken im Hinterland. So rottet sich in New Jersey ein feindseliger Mob zusammen und verwandelt sich zwar nicht in Nashörner, so doch in Mammuts, die alles niedertrampeln. Da Rushdie gerne mit Zaunpfählen winkt, gibt er dem Motel, in dem seine Helden übernachten, den Namen „JONÉSCO Motor Inn“ – in Versalien. Und für die ganz Begriffsstutzigen verweist Quichotte auf Seite 425 auf seine „Dankesschuld gegenüber Ionescos ,Nashörnern‘“. Man wird diese Episode unter Firlefanz verbuchen dürfen.
Selbstverständlich lässt es Rushdie nicht bei dieser einen Handlung bewenden. Sein literarischer Ehrgeiz erfordert es, mit mindestens zwei, wenn nicht drei Textebenen zu jonglieren. Der Roman soll mit der Brillanz seiner kunstfertigen Mehrfachverblendung den Leser blenden. Also erfindet Rushdie einen Autor des Quichotte-Romans, den wir gerade lesen, und verpasst diesem eine Biografie, die in allen Eckpunkten die Biografie des Helden seines Romanmanuskripts spiegelt, an dem er gerade schreibt. So laborieren beide, Quichotte und sein fiktiver Autor, an einem schwierigen Vater-Sohn-Verhältnis und einem Zerwürfnis mit einer krebskranken Schwester. Auch sonst findet jedes Detail des Quichotte-Manuskripts seinen exakten Widerpart im Leben seines Verfassers.
Nicht genug der Verschachtelung: Hinter der Autor-Figur wird, wie könnte es anders sein, ein rushdiehafter Schöpfergott erkennbar, der seine Erinnerungen an das Kinderparadies in Bombay vervielfältigt, indem er sie in die Biografien Quichottes, Salmas sowie ihres Autors implantiert. Diese penetrante Spiegelbildlichkeit verleidet einem auf Dauer jedes Lesevergnügen: Es macht die Orientierung zwischen den Erzählebenen zugleich mühsam, verwirrend und reizlos.
Und was bringt all der Aufwand? Er staffiert einen lärmenden Roman aus, der im Vorübergehen alle Themen anreißt, die jeder aufmerksame Medienkonsument und Internetsurfer ohnehin kennt. „Quichotte“ will allen alles sein und zieht deshalb alle Stil- und Genreregister gleichzeitig: Cervantes-Persiflage, Literaturmuseum, Archiv der Junk-Kultur, Zeitgeist- und Mediensatire, Trumpworld-Kritik, Familiendrama, Science-Fiction, Spionageroman, pikareske Roadnovel, Cyber-War-Dystopie und apokalyptische Endzeitvision.
Mit einem unguten Völlegefühl empfiehlt sich der Leser. Endlich Stille.