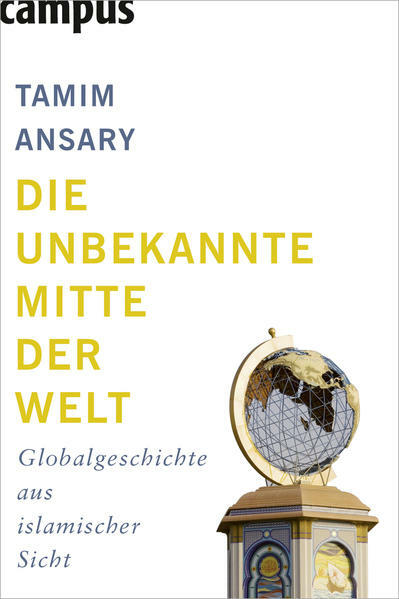Religiöse Splittergruppen und ihresgleichen
Sebastian Kiefer in FALTER 10/2010 vom 10.03.2010 (S. 36)
Mit seiner "Globalgeschichte aus islamischer Sicht" liefert Tamim Ansary keinen Beitrag zur Verständigung
Das 2007 angelaufene Projekt Corpus Coranicum in Berlin arbeitet daran, die erste historisch-kritische Textausgabe des Koran herzustellen. Die islamische Hemisphäre hat sich solchen historisch-kritischen Herangehensweisen bislang fast vollständig verweigert. Dabei ist ihr religiöses Referenzbuch, der Koran, naturgemäß eine Kompilation verschiedenster, oft volkstümlicher Legenden und Legitimationsformen, Mythen und Erzählstereotypen und ohne die Einbettung in spätantike Theologien, Lebenswelten und Praktiken eigentlich gar nicht zu verstehen.
Und die einzigen Quellen über Mohammed stammen von Muslimen – wer aber würde heute die Geschichte einer kampfbereiten religiösen Splittergruppe schreiben anhand von Zeugnissen alleine aus dieser Gruppe?
Die Folgen dieser anhaltenden Weigerung sind gewaltig, denn die Lebensführung des Propheten gilt als Vorbild für alle Muslime (die sich als Teil der "sunna" verstehen) und stellt neben dem Koran und den Hadiths die dritte Quelle des Rechts im Islam dar.
Damit werden ethische Normen, weltanschauliche Grundsätze und Erkenntnismodelle einer stammesmäßig organisierten, halb nomadischen, halb städtischen Welt konserviert. Das betrifft die Rückführung auf eine fiktive Gründergestalt (Mohammed erfindet eine Abstammungslinie Moses – Ismael – Abraham – Adam), das Führerprinzip als Organisationsform, den absoluten Vorrang der Sippe vor dem Einzelnen, der andererseits auch von jener vor Unbill geschützt wird – und die Stabilisierung der Gruppe durch von Geistern inspirierte, charismatische Dichter (der Koran muss mehrfach bestreiten, dass ihr Prophet Mohammed eben ein solcher "inspirierter" Dichter sei).
Der alles andere als "islamophobe" Islamwissenschaftler J. C. Bürgel hat den Kern des Islam als das Bestreben bezeichnet, alle Lebensbereiche zu heiligen, indem man sie der Allmacht des Koran unterwirft. Die zentrale "Daseinserfahrung" sei, Gottes Allmacht innerhalb einer Gruppe, die sich dem "Recht" unterwirft und für dieses streitet, "nahezukommen" oder in ihr aufzugehen.
Ein Hauptbeweis für den göttlichen Ursprung der Sendung Mohammeds war denn auch die Macht, militärische Siege zu erringen – diese Basisideologie wurde erst durch die vollständige Niederlage gegen die Mongolen erschüttert, doch in Varianten verteidigt.
Ein erheblicher Teil der Muslime in den Metropolen und mehr noch den Emigrantenmilieus lebt mittlerweile in Distanz oder Entfremdung zu dieser ursprünglichen Grunderfahrung der Muslime. Letztere muss man kennen, um zu ermessen, wie schwierig die Aufgabe ist, die sich der säkulare Publizist Tamim Ansary mit seinem Buch "Die unbekannte Mitte der Welt. Globalgeschichte aus islamischer Sicht" gestellt hat: Er will in populärem Ton für den islamischen Raum das liefern, was wir etwa für den chinesischen Kulturraum längst besitzen: eine Beschreibung der zivilisatorischen Entwicklung aus dem Blickwinkel nichteuropäischer Kulturen.
Ansary macht sich an die heikle Aufgabe mit einer enormen Begabung für die anschauliche Vereinfachung äußerst komplexer Vorgänge und mit großer Lust am (teils störend ironisierenden) Erzählen. Vielleicht findet man die verwickelten Abfolgen der Geschlechter und Kriege im Vorderen Orient bis hin zum Indus nirgendwo farbiger, schlichter, anschaulicher erzählt als hier. Das kann dann ebenso charmant wie lehrreich selbstgefällige Westler daran erinnern, ihre Hausaufgaben zu machen, bevor sie über "den Islam" schwadronieren.
Allerdings hat diese Leistung einen Pferdefuß. Dass sich angesichts des gewaltigen Stoffes Sachfehler einschleichen (die Dampfhydraulik wurde nicht von Muslimen, sondern von Heron aus Alexandria erfunden), ist unvermeidlich. Dass Ansary über Mohammed in unhinterfragter, distanzloser Paraphrase islamischer Texte erzählt, stereotype Legenden, taktische Fiktionen und Mystifikationen als Beschreibungen historischer Ereignisse ausgibt, ist fatal.
Er tut das, um der Perspektive des gläubigen Muslim zu ihrem Recht zu verhelfen, doch er erreicht damit das Gegenteil: Wenn das die Perspektive auf die Geschichte der arabischen Halbinsel um 600 n.Chr. ist, dann kann es keine fruchtbare Verständigung geben, sondern bestenfalls ein desinteressiertes Nebeneinanderher, wie es die Mehrheit der Europäer etwa mit den Teilen der katholischen Kirche praktiziert, die ein ähnliches Verhältnis zu den Dokumenten der jüdischen religiösen Splittergruppe um einen Wanderprediger aus Nazareth beibehält.