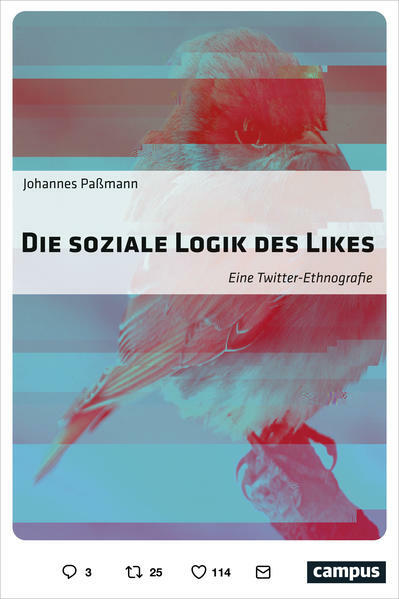Suche Gemeinschaft, biete Like
Anna Goldenberg in FALTER 29/2018 vom 18.07.2018 (S. 21)
Vor 100 Jahren beobachtete der polnische Anthropologe Bronisław Malinowski auf den Trobriand-Inseln im Südpazifik ein eigenartiges Ritual: Regelmäßig machten sich Bewohner im Kanu auf den gefährlichen Weg zu den Nachbarinseln, um dem Oberhaupt des dortigen Stammes Schmuck zu schenken. Dieser Austausch von Geschenken zwischen den 18 Inselstämmen, Kula-Ring genannt, sei notwendig für die Gemeinschaft, mutmaßte Malinowski. Denn die Geschenke geschahen zwar freiwillig, doch entstand dabei die Verpflichtung, sie zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Gegengabe zu erwidern. Vereinfacht gesagt: Wer sich beschenkt, bekriegt sich nicht.
Vor neun Jahren registrierte sich der deutsche Medienwissenschaftler Johannes Paßmann auf Twitter und beobachtete auf der Kurznachrichtenplattform ein eigenartiges Ritual: Wer dort neu ist, bekommt erstmal Geschenke von Fremden – in der Form von positivem Feedback auf die selbstgeschriebenen Tweets. Andere User können diese nämlich mit nur einem Mausklick als gut bewerten („Like“) oder sogar teilen („Retweet“), negative Rückmeldungsmechanismen gibt es nicht.
Paßmann hat, ähnlich wie Malinowski die Trobriander, die deutsche Twitter-Community jahrelang als teilnehmender Beobachter erforscht. In seine kürzlich erschienene Twitter-Ethnografie fließen Paßmanns persönliche Erfahrungen und Begegnungen ein. Den Mikrobloggingdienst gibt es seit 2006; weltweit hat dieser heute mehr als 330 Millionen User, die mindestens einmal im Monat aktiv sind. Die Zahl der österreichischen Accounts wird auf rund 150.000 geschätzt.
Paßmanns These: Die „Likes“ und „Retweets“ machten den rasanten Aufstieg von Twitter überhaupt erst möglich. Wie im Kula-Ring der Trobriander werden sie freiwillig gegeben, als Geschenke an (zunächst) Fremde. Denn wer einen anderen Tweet mit einem „Like“ versieht oder weiter teilt, heißt damit nicht nur den Inhalt des Tweets gut, sondern erwartet sich auch eine Gegengabe. So bildet sich eine Gemeinschaft.
„Man likt sich, dann folgt man sich, irgendwann trifft man sich möglicherweise“, sagt Paßmann. Die Like-Herzchen funktionieren als Signale, die zeigen, was die Gemeinschaft gerade gutheißt. So entstehen ein gemeinsamer Humor und eine eigene Sprache für die Tweets. Jene „Bubble“ oder Blase, im Deutschen Twitter, die Paßmann erforschte, wird heute „Schmunzeltwitter“ genannt. In dieser Onlinegemeinschaft, in deren Kern sich laut Paßmann nicht mehr als 150 Menschen befanden, entwickelte sich ein Humor, der sich über die Konventionen des beruflich und sozial erfolgreichen Erwachsenenlebens lustig machte: „Man traute sich, Dinge ins Internet zu schreiben, die eigentlich peinlich sind“, sagt Paßmann und nennt das eine „Souveränitätsgeste“, also ein Zeichen der Unabhängigkeit von den Konventionen. Ein typisches Beispiel ist ein Tweet von User GebbiGibson vom Oktober 2011: „Abends gehe ich oft mit einer Schüssel Nudelsalat spazieren, um den Eindruck zu erwecken, ich hätte Freunde, die mich zu Partys einladen.“ Rund 3500 User klickten „Like“.
Mittlerweile hat sich Twitter gewandelt, ist größer, politischer und ernsthafter geworden. Doch die Souveränitätsgesten sind geblieben. Hinterfragt wird nicht mehr, was es bedeutet, nicht auf Partys eingeladen zu sein – sondern (vermeintlich) fehlendes Rassen-, Klasse- und Geschlechtsbewusstsein: „Seit etwa zwei oder drei Jahren sind die aufsteigenden Twitterer nicht mehr die, die souverän Infantilität inszenieren, sondern solche, die sich souverän als ungebildet geben, etwa durch fehlende Interpunktion, falsche Konjugation und Rechtschreibung, Disney-Klischees, platten Unternehmersprech und vieles mehr, in dieser vermeintlichen Ungebildetheit aber teils große Raffinesse zeigen, etwa indem sie Race-, Class- und Gender-Stereotype entlarven.“ So geschehen etwa beim Shitstorm gegen die Spiegel-Geschichte über Österreich (siehe Seite 22), bei der die fehlende Diversität der Interviewten kritisiert wurde.
Apropos Shitstorm, definiert als das extrem gehäufte Auftreten negativer Kritik auf sozialen Netzwerken: Wer sich beschenkt, bekriegt sich nicht, gilt eben nicht so recht für Twitter. Schuld daran ist die Unklarheit. Bei Shitstorms geht es meist um eine moralische Frage, bei der die verschiedenen Positionen zuvor unklar waren und nun öffentlich ausgehandelt werden. Ein Shitstorm ist häufig kleiner, als er scheint. Denn es sind nur vergleichsweise wenige User – und wenige Postings –, die daran aktiv beteiligt sind. „Der größte Teil der User auf sozialen Plattformen, bis zu 90 Prozent, schaut bestenfalls nur zu. Sie sagen weiterhin nichts“, sagt Paßmann, und was sie über die Frage denken, bliebe unklar. Und genau diese Unklarheit sorge für das Gefühl, dass eine riesige Masse der gleichen Meinung sei: „Shitstorms instrumentalisieren diese Vagheit. Jeder kann Mehrheiten für sich in Anspruch nehmen.“
Überhaupt, diese Unklarheit. Sie ist für soziale Medien maßgeblich. Alles Geschriebene lässt viel Interpretationsspielraum. Dazu kommt, dass die Bedeutung von „Likes“ und „Retweets“ vage ist. „Ich kann mir selbst ausmalen, was damit gemeint ist“, sagt Paßmann. Die Trobriander trafen sich zum Geschenkeaustausch, die Bedeutung war geregelt. Klarheit schafft also, mit dem Kanu vorbeizurudern und ein „Like“ persönlich vorbeizubringen