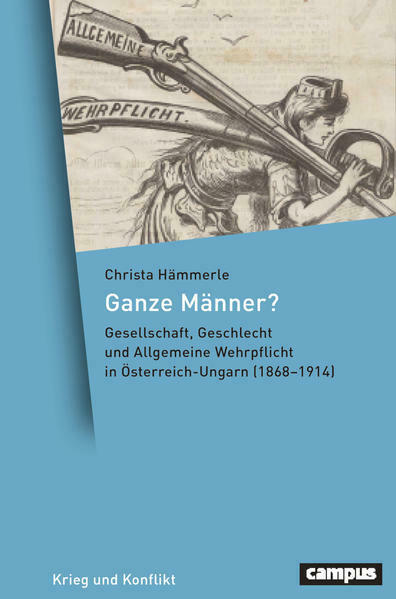"Rekrutenschädl, ich werde Ihnen geben ..."
Florian Wenninger in FALTER 17/2023 vom 26.04.2023 (S. 22)
Erinnert sich noch jemand an die Volksbefragung zur Wehrpflicht 2013? ÖVP und FPÖ sprachen sich für eine Beibehaltung der Wehrpflicht aus, SPÖ und Grüne für ein Berufsheer. Das wesentlichste Argument für die Beibehaltung der Wehrpflicht war der Zivildienst. Ohne diesen, so fürchteten viele, sei das heimische Gesundheitssystem substanziell bedroht. Rund 150 Jahre nach der Einführung des obligatorischen Dienstes an der Waffe war das zugkräftigste Argument für dessen Beibehaltung also, dass man ihn auch weiterhin verweigern können müsse.
Ein Jahrzehnt später steht außer Frage, dass der russische Überfall die militärische Lagebeurteilung in Europa nachhaltig verändert hat. Verschiedentlich wird nun auch versucht, eine neue sicherheitspolitische Debatte loszutreten. Diese wird unweigerlich auch die Frage der Wehrpflicht berühren.
Die Historikerin Christa Hämmerle widmet sich also einem zutiefst aktuellen Thema, wenn sie, gestützt auf einen enormen Quellenfundus, die Frühgeschichte der Wehrpflicht von deren Einführung 1868 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 untersucht. Der besondere Vorzug des Buches liegt dabei darin, das Militär nicht isoliert zu betrachten, sondern es in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Hämmerle spürt dementsprechend nicht nur den militärischen Konsequenzen der Wehrpflicht nach, sondern interessiert sich dafür, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn plötzlich die gesamte männliche Bevölkerung Jahre ihres Lebens in Kasernen und auf Exerzierplätzen zubringen muss.
Wie veränderte der Umstand, dass fortan alle dienen mussten, sowohl das Denken der zivilen und militärischen Entscheidungsträger als auch der Betroffenen selbst?
Nach einer lohnenden Reflexion theoretischer und methodischer Fragen fokussiert das Buch besonders auf drei Aspekte. Erstens auf die politischen Debatten rund um die Reform des Wehrgesetzes 1867, die unmittelbar eine Reaktion auf das Desaster von Königgrätz im Jahr zuvor darstellte, in einem größeren Kontext aber einem europäischen Trend folgte: der Indienstnahme der ganzen Nation für die moderne Kriegsführung.
Zweitens untersucht Hämmerle die praktischen Konsequenzen der allgemeinen Dienstpflicht für das Militär, insbesondere für dessen taktische Überlegungen und die Frage, wie das neu herangeführte "Menschenmaterial" in deren Sinne tunlichst feldverwendungsfähig zu machen sei, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die multiethnische Herkunft der Rekruten.
Der dritte Teil ergänzt schließlich die Perspektiven von außen (Politik) und von oben (Armeeführung) um jene von unten: Wie erlebten junge Männer ihren Militärdienst? Wie wurden sie behandelt und wie integrierten sie diese Erfahrungen, wie prägte es ihr ideologisches Selbstverständnis, aber auch ihr Geschlechterrollenbild? Nicht zuletzt: wie versuchten manche von ihnen, sich dem Dienst an der Waffe zu entziehen -und weshalb?
Christa Hämmerle hat in einer beeindruckenden Arbeit eine klaffende Forschungslücke ein gutes Stück geschlossen. In einer auch für Nichthistoriker ausgezeichnet lesbaren Form demonstriert sie dabei exemplarisch, wie spannend, anregend und gesellschaftlich relevant eine innovative Militärhistoriografie sein kann, die sich nicht in technischen oder organisationsgeschichtlichen Abhandlungen verliert, sondern das Militär konsequent als soziale Sphäre denkt.