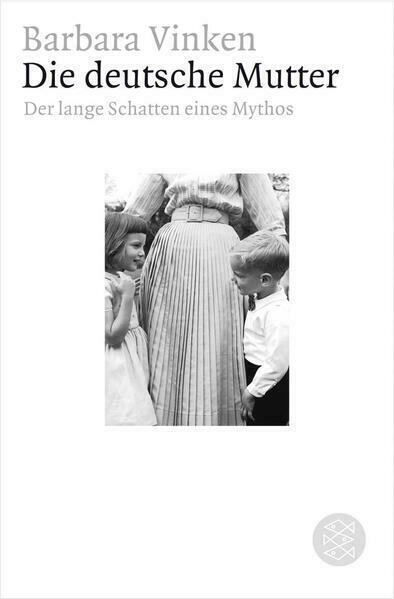Liebe Mami oder kaltes Weltweib: Muttersein im Schatten der Vergangenheit
Gerlinde Pölsler in FALTER 10/2017 vom 08.03.2017 (S. 56)
Von Luthers Hausfrau über den „Lebensborn“ der Nazi bis zu Hera Linds „Superweib“ spannt die Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken den historischen Bogen. „Wie der Nagel in der Wand“ gehörte laut Luther die Frau als Ehegattin und Mutter in die Familie und hatte für deren leibliches Wohl zu sorgen. Im 19. Jahrhundert gesellten sich die pädagogischen Lehren Rousseaus und Pestalozzis hinzu.
Demnach bedarf die Familie der mütterlichen, aufopfernden Liebe als Gegenmodell zur kalten Außenwelt. Pestalozzi erfand das Gegensatzpaar von „Weltweib und Mutter“. An diesem „Dogma der deutschen Mutter“, wonach ein Beruf den Kindern und die Kinder dem Beruf schaden und man nicht beides haben kann, finde auch heute noch die Emanzipation der Frauen ihre Grenze.
Zu diesem Ergebnis kam Vinken, Mutter eines Kindes, in ihrem 2001 erschienenen Buch; dabei blieb sie auch in der 2011 aktualisierten Version. Seine Familienpolitik habe Deutschland gegenüber westeuropäischen Standards um 40 Jahre zurückgeworfen. Auch jetzt, wo die Politik sich diesen geöffnet habe, sei das Dogma in den Köpfen immer noch wirkmächtig.
Vinken seziert leidenschaftlich und messerscharf. Die Forderung nach Aufopferung werde vor allem von Männern laut, die gar nicht wüssten, wovon sie redeten. Sie stellt spannende historische Zusammenhänge her; ihr Ziel klingt gut: dass „Mütter als normale Erwachsene in einer Welt der normalen gesellschaftlichen Verpflichtungen, der politischen, erotischen, wirtschaftlichen Bewegungen und Attraktionen weiterleben können“.
Mitunter ist ihr Tonfall aber unerbittlich, auch den Frauen gegenüber, die Vinken als retro empfindet. Man kann ihr entgegenhalten, dass es zwischen Nichterwerbstätigkeit und 40-Stunden-Woche Abstufungen (für beide Eltern!) gibt, die sich zudem mit dem Alter der Kinder verändern. Die Rolle der Väter bleibt bei Vinken weitgehend außen vor; viel wichtiger als deren Beteiligung seien Kinderbetreuungseinrichtungen.
Mit einem aber hat sie wohl recht, wie auch die niedrigen deutschen und österreichischen Geburtenraten zeigen: „Erst wenn es für uns wie für unsere Nachbarinnen selbstverständlich geworden ist, Mutter, Anwältin und Frau zu sein, (…) gibt es wieder mehr Chancen auf das Glück, das Kinder sind.“
„Mummy-Style? Das ist die Katastrophe an sich“
Barbaba Tóth in FALTER 18/2016 vom 04.05.2016 (S. 43)
Die Münchner Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken über unschuldige und überpraktische Müttermode, den spezifischen Stil deutscher Mütter und warum Französinnen es am Ende doch besser machen
Vinken ist Literaturwissenschaftlerin, aber einem breiten Publikum wurde sie durch zwei populärwissenschaftliche Bücher bekannt. In „Die deutsche Mutter. Der lange Schatten eines Mythos“ beschreibt sie, wie sich das Mutterbild seit der Reformation gewandelt hat. In „Angezogen. Das Geheimnis der Mode“ erklärt sie, welchen Zyklen Moden unterworfen sind und welchen Einfluss die Emanzipation der Frau unter anderem auf Männerkleidung hat. Was liegt also näher, als im Vorfeld des Muttertages mit Barbara Vinken über Mütter und ihre Kleider zu sprechen?
Falter: Frau Professor Vinken, wie hat sich die Mode für Mütter historisch verändert?
Vinken: Im Ancien Régime gab es noch gar keine spezielle Mode für Mütter. Maria Theresia hatte 16 Kinder. Man schnürte dann eben einfach das Korsett nicht so eng und ließ die Kleider lockerer fallen. Auf Renaissancebildern sieht man bei unter der Brust geschnürten Kleidern im Empire-Stil bloß, dass die Falte eben weiter aufgeht und den Bauch fasst. Im 20. Jahrhundert war das Sehen des Bauches ein großes Problem. Zum Beispiel durften Lehrerinnen nicht unterrichten, wenn sie schwanger waren. Das galt als unzüchtig und unschicklich. Der schwangere Körper machte offensichtlich, dass frau Sex hatte – damals, das war vor der Möglichkeit künstlicher Befruchtung. Deswegen setzte die Muttermode sehr lange auf Unschuldigkeit. Kleine Blümchen, Rüschen, Pastellfarben sollten das Offensichtlichwerden des Sex vergessen machen. Die Gegenbewegung in den 1960er-Jahren setzte dafür auf die besondere Betonung der Schwangerschaft. Schlauchartige Ringelkleider setzten den Bauch kugelrund ins rechte Licht. In den letzten Jahren, scheint mir, gehen wir wieder zurück ins Ancien Régime: Es gibt keine spezielle Schwangerenmode mehr, sondern man trägt Kleider, die vielleicht weiter geschnitten sind, im Empire-Stil, in A-Linie, die man dann auch später weiter tragen kann. Oder sehr tief sitzende Hosen. Nichts mehr zu verstecken, aber auch nichts, was betont werden müsste. Schwangerschaft als auch normaler Teil des Lebens.
Die typische Mutter in Wien, aber auch
in Berlin oder München trägt derzeit
gerne einen Parka, eine Umhängetasche,
dazu Sneaker und eine schmal geschnittene Jean, Lederleggings. Es scheint die Standardausrüstung zu sein.
Vinken: Das Wort Standardausrüstung passt gut zu dem, was Sie beschreiben. Da denkt man immer an Im-Dienst-Sein, quadratisch, praktisch, gut. Eine Ausnahmesituation, in der es zu bestehen gilt. An Firlefanz wie Mode kann jetzt nicht gedacht werden und morgens gibt es Wichtigeres als Lippenstift. Meine Kleidung soll funktionieren, im Alltag mit den Kindern praktisch und vor allem bequem sein; schön oder elegant ist anders.
Finden Sie die Kombination aus Parka, schmalen Hosen und Sneakern hässlich?
Vinken: Hässlich nicht. Nichtssagend. Stellen wir uns als Gegenmodell einmal ein Polkadot-Kleid aus den Fünfzigerjahren vor, dazu Pumps mit Pfennigabsätzen. Oder ein weit schwingendes Blumenkleid, einen Bleistiftrock mit Bluse und High Heels. Was urbane Mütter einer bestimmten Schicht in Österreich und Deutschland derzeit gerne tragen, ist Normcore, definitiv.
Sie haben diese Mode, vor allem das Zeigen der Beine in eng anliegenden Hosen aus Leder, Jeansstoff und Ähnlichem, in ihrem Buch „Angezogen“ als Folge der Emanzipation beschrieben. Früher, zur Zeit Ludwigs des Sonnenkönigs etwa, war es mächtigen Männern vorbehalten, ihre Beine so zu inszenieren. Dass es jetzt Frauen machen, zeigt, wie viel Macht sie in der Gesellschaft dazugewonnen haben. Inszenieren sich Mütter deswegen so?
Vinken: Diese Silhouette ist inzwischen ja eigentlich schon wieder überholt. Man geht zurück zu den Fifties, zu den Seventies: weite Röcke, wieder länger, bei den Hosen ist man wieder bei der Culottes. Diese in meinem Buch beschriebene hochbeinige Linie ist zwar noch die Standardlinie, aber sie ist keine modische Linie mehr. Was mir auffällt, wenn ich deutsche oder österreichische Mütter mit kleinen Kindern sehe, ist, dass sie im Gegensatz zu Italienerinnen oder Französinnen nicht die Weiblichkeit feiern, sondern das Praktische betonen. Sie verwischen das Weibliche zugunsten der Funktion. Ich würde nicht sagen, dass da etwas Emanzipatives dran ist, im Gegenteil. Es entspricht ganz der alten Linie: mehr Mutter, weniger Frau.
Die deutsche oder österreichische Mutter ist also immer noch eine andere, mit anderen Vorstellungen und anderem Stil?
Vinken: Ja. Das Sich-Schmücken als Frau ist für italienische oder französische Frauen auch weiterhin selbstverständlich, nachdem sie Mutter geworden sind. Bei uns wirkt es wie ausradiert, ausgelöscht, durchgestrichen. Ein Parka, Turnschuhe – das sind starke sportliche, paramilitärische Elemente. Sie betonen Funktionalität, nicht Schönheit.
Lassen sich solche nationalen, funktionalen Moden aus der deutschen Kulturgeschichte erklären?
Vinken: Die Aristokratie in Deutschland wollte sich aus dem Geist der Aufklärung bildungsbürgerlich mit einem Bild von der Mütterlichkeit reformieren, die das Gegenbild zur weiblichen Verführung, zu Weiblichkeit schlechthin sein sollte. Weiblichkeit, das war Manipulation, Gefahr, Verstörung, Zerstörung. Die Mutter hingegen galt als integre, heilsbringende Kraft, als opferwillig, liebend und vernünftig. Pestalozzi formuliert die Alternative zwischen Mutter und Frau am klarsten: Weltweib oder Mutter. Weltweib stand für Eitelkeit, Mondänität, selbstverblendeten Egoismus: All das sollte die gute Mutter reformieren und läutern. Die Mutter wird nicht biologisch gedacht, sondern sie bestimmt sich durch richtiges, ethisches Verhalten. An ihrem Wesen soll die Welt genesen.
Dieses Bild haben die Nationalsozialisten auch aufgegriffen und es wirkt offenbar noch lange nach. So lange, dass es inzwischen eine Art Sehnsuchtsliteratur gibt, die die französische Mutter heroisiert. Dazu gehören Stilbibeln, wie man so gelassen und schick wie Pariser Mamas wird, Ratgeber, die einem erklären,
warum französische Kinder nicht schreien.
Wie halten sich solche kulturellen Unterschiede so lange?
Vinken: Den Französinnen suggeriert niemand, dass sie aufhören müssen, Frauen zu sein, wenn sie Kinder kriegen; niemand verlangt von ihnen, dass sie Halbzeit arbeiten und damit nicht mehr konkurrenzfähig sind. Die Vorstellung, dass nach dem Kind eben nicht alles ganz anders ist als davor, ist entspannend. Französische Frauen bekommen Kinder und arbeiten weiter, sie hängen ihr Liebesleben nicht an den Nagel – und sie tauschen ihren Kleiderschrank nicht aus. Sie steuern eben nicht auf die Total-Conversion zu. Es ist nun mal amüsant und emanzipiert, Mutter zu werden und Frau bleiben zu dürfen. Und auch nicht gleich als karrierebehindert zu gelten. Französinnen, die ihre Kinder in die Krippe bringen, sind geschminkt und tragen hohe Schuhe; sie sind schließlich auf dem Weg zur Arbeit. Und sehen eben nicht wie Mutter im Volldienst aus. Wenn Frauenmagazine vom Mummy-Style reden, dann ist das schon die Katastrophe an sich.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: