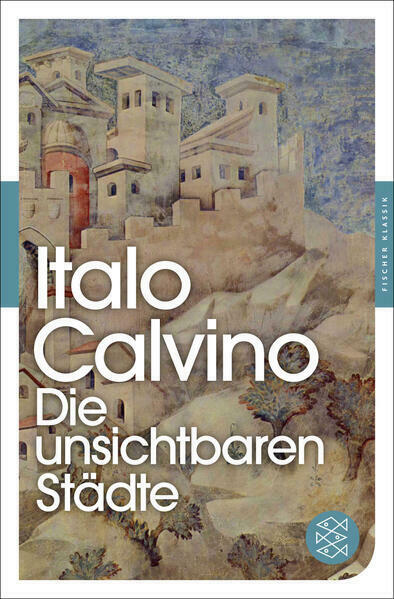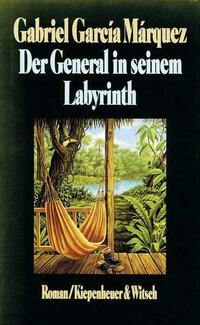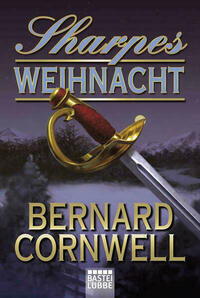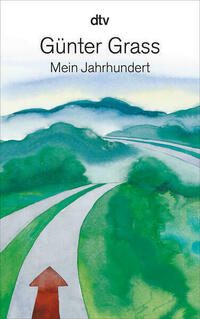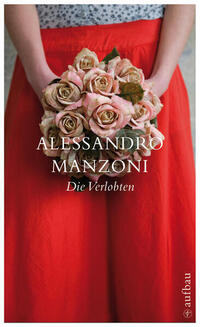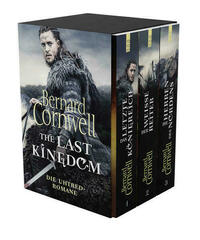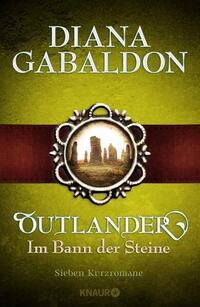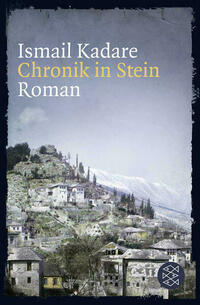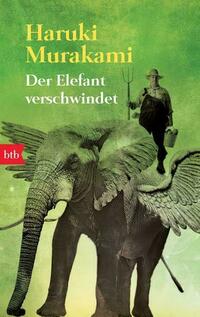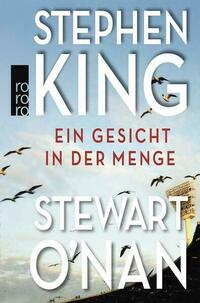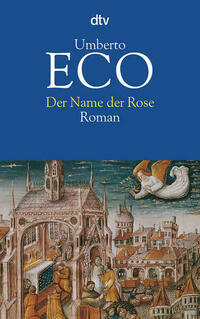Von Beton bis Bobo, Spaß miteingeschlossen
Maik Novotny in FALTER 20/2015 vom 13.05.2015 (S. 62)
Eine Lesetour durch die Stadt des 20. Jahrhunderts: Die Standards der Städtebauliteratur im subjektiven Schnelldurchlauf
Wer sich umfangreiches Wissen über die Geschichte des Städtebaus aneignen will, dem sei ein entsprechendes mehrjähriges Studium empfohlen. Wem dazu die Zeit fehlt, der kann zumindest aus dieser Kurzauswahl von Literatur zur Stadt des 20. Jahrhunderts etwas Nützliches für den nächsten Städteurlaub finden.
Eines der ersten Standardwerke erschien fast pünktlich zur letzten Jahrhundertwende: Ebenezer Howards „Garden Cities of Tomorrow“ (1902). Der von sozialreformatorischen Gedanken geprägte, pazifistische Esperanto-Fan Howard propagiert darin die Gartenstadt als Hybrid zwischen Stadt und Land als das Beste beider Welten und schuf in seinen schematischen Layouts ringförmig angelegter Städte die Grundlage für britische Gartenstädte wie Letchworth und Welwyn und die Gartenstadt Hellerau bei Dresden. Echos seiner Ideen finden sich im ganzen Jahrhundert, von der Öko- und Friedensbewegung bis zu den Stadtneugründungen der Nachkriegszeit.
Als Antipode zur grünen Idylle kann Bauhaus-Professor Ludwig Hilberseimer gelten, der in „Großstadtarchitektur“ 1927 die Forderung nach der Identität von Konstruktion und Form stellte und Stahl, Glas und Beton als ideale Baustoffe für die Großstadt pries, fern von „unarchitektonischen dekorativen Phantastereien“. Dennoch war Hilberseimer keineswegs ein stahlharter Technokrat, ihm ging es um die Sensibilität für das richtige Mittel zum richtigen Zweck. Seine von horizontalen Linien geprägten Idealstadtbilder wurden später dennoch zur Ikone der gesichtslosen modernen Stadt.
Genau diese bekämpfte eine Generation später der Publizist Wolf Jobst Siedler. Sein Buch „Die gemordete Stadt“ war 1964 eines der ersten, das die Zerstörung der Gründerzeitviertel beklagte, deren Altbau-Ornamente nach dem Krieg als hässlich und nutzlos galten und deren nach der Stadtbaukunst des 19.Jahrhunderts angelegte Plätze und Alleen den freien, oft überdimensionierten Räumen der Moderne geopfert wurden. Einerseits trug Siedlers polemische Nostalgie ihm den Ruf eines Vorläufers der Grünen ein, andererseits bekam er Beifall von altpreußisch-konservativer Seite, die heute im steinernen Nachwende-Berlin mit dem Frankenstein-Monstrum des rekonstruierten Stadtschlosses wieder Oberwasser hat.
Ein Jahr später schlug der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich in eine ähnliche Kerbe, doch aus entgegengesetzter Richtung, nämlich von links. In seinem 1965 erschienenen kurzen Pamphlet „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ kritisierte er die moderne Stadt der Nachkriegsjahre als gesichtslos und gleichförmig, ohne Möglichkeit, dem Großstädter Heimat und Identifikation zu bieten. Profitgier und Konkurrenzgesellschaft verhinderten zudem engere soziale Kontakte – die Wurzel allen Übels sah Mitscherlich, im Unterschied zu Wolf Jobst Siedler, im Privateigentum. Kein Wunder, dass sein Buch vor allem von den 68ern in höchsten Tönen gelobt wurde.
Ganz anders, nämlich absolut euphorisiert und fasziniert, näherte sich der niederländische Architekt Rem Koolhaas der Stadt. Sein 1978 erschienenes Werk „Delirious New York“ (siehe auch sein Porträt auf Seite 16) versuchte den Regeln des in den 100 Jahren zuvor nach eigenen Gesetzen gewachsenen New York auf die Spur zu kommen. „Manhattan“, schreibt Koolhaas, „ist der Stein von Rosette des 20. Jahrhunderts, voller architektonischer Mutationen, utopischer Fragmente und irrationaler Phänomene.“ Koolhaas, der seine Laufbahn als Journalist begann, vermischt Geschichtsforschung, Erzählung und architektonische Analysen, sein Buch ist bis heute enorm einflussreich und legte den Grundstein für die steile Karriere des Autors zum globalen Stararchitekten.
Eines der prägendsten Bücher zumindest im deutschsprachigen Stadtdiskurs der 1990er-Jahre ist zweifellos Thomas Sieverts‘ 1997 erschienenes „Zwischenstadt“. Darin widmet er sich einem bis dahin weitgehend ignorierten Phänomen: dem Urban Sprawl, also der Ausuferung der Städte ins Land, in deren Schnittmenge ein amorphes „Weder-noch“ entsteht, ein planloses Meer an Suburbs, und das nicht nur in den USA, sondern auch in europäischen Ballungsräumen wie Frankfurt am Main.
Wenn es ein urbanistisches Werk gibt, das die Nullerjahre am besten widerspiegelt, dann ist es zweifellos Richard Floridas 2002 erschienene Bobo-Bibel „The Rise of the Creative Class“, mit der vielfach reproduzierten und von Stadtoberen gierig aufgesaugten Rezeptformel, wonach Städte, in denen kreative und innovative Jobs entstehen und sich Künstlerinnen, Designer und Wissenschaftler ansiedeln, ökonomisch im Vorteil seien, da die kreative Klasse einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren sei. Kritiker seiner Theorie monierten verkehrt aufgezäumte Kausalketten, ungenaue Statistiken und vage Definitionen (so zählt der Autor etwa auch Finanzmakler zu den Kreativen), doch das Buch wurde zur Bestseller-Blaupause der Bohemiens von Williamsburg bis Mariahilf und trug wesentlich zur bis heute andauernden Gentrifizierungsdebatte bei.
Ist der Kopf nun schwer vom theoretisch-urbanistischen Überbau, dann hier zum Schluss etwas Spaß aus der urbanen Praxis: „The Lonely Planet Guide to Experimental Travel“ (erschienen 2005) ist auf jede beliebige Stadt anwendbar. Inspiriert von den aufs Spontan-Unbewusste zielenden Strategien der Situationisten der 1960er-Jahre um Guy Debord schlägt der liebevoll illustrierte Reiseführer 40 Experimente für ungewohnte urbane Erfahrungen vor: sich einen Hund leihen und von ihm durch die Stadt ziehen lassen, 24 Stunden am Flughafen verbringen, ohne wegzufliegen, sich als Backpacker-Tourist durch den Heimatort bewegen, getrennt vom Partner in dieselbe Stadt reisen und sich dort zu treffen versuchen oder schlicht und einfach: würfeln.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: