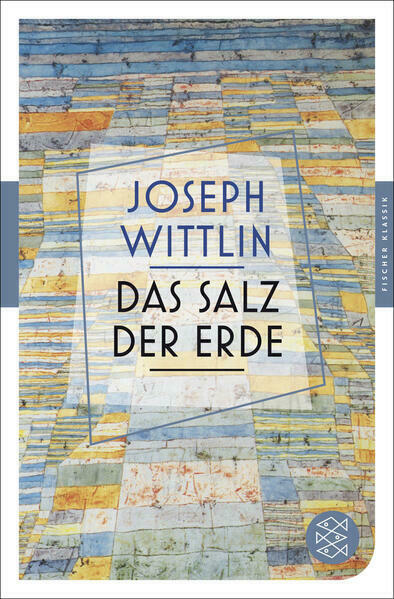Der Kaiser schickt Soldaten aus
Klaus Nüchtern in FALTER 24/2014 vom 11.06.2014 (S. 37)
"Das Salz der Erde", Joseph Wittlins Jahrhundertroman über den Ersten Weltkrieg, wurde neu aufgelegt
Das Wetter ist immer ein Bringer. In Joseph Roths "Radetzkymarsch" wird die Nachricht von der Ermordung des Thronfolgers, die vom Grafen Benkyö mit dem Freudenschrei "Das Schwein ist hin!" quittiert wird, von einem unheilvoll sich ankündigenden und schließlich gewaltig losbrechenden Gewitter präludiert. "Zwischen dem Blitz und dem Donner drängte sich die Ewigkeit selbst zusammen. (
) Es war als erlebten sie überhaupt zum erstenmal ein Gewitter."
Joseph bzw. Józef Wittlin, der mit Roth eng befreundet war und dessen Romane "Hiob" und "Die Kapuzinergruft" ins Polnische übersetzt hat, macht sich gleich die – historisch verbürgte – totale Sonnenfinsternis vom 21. August 1914 zunutze.
In seinem im polnischen Original 1935 und zwei Jahre später – beim Amsterdamer Verlag Allert de Lange – auf Deutsch erschienenen Roman "Das Salz der Erde" macht das rare astronomische Geschehen einen dramatischen apokalyptischen Effekt und entsprechenden Eindruck auf den Protagonisten des Romans:
",Was ist das? Die Sonne erlischt ja! Sie steht genau in der Mitte des Himmels, sie steht im Süden und erlischt!' In düsterer Leere hängend, verlosch die Sonne in dunkelroter Agonie, wie eine riesige, runde Glühbirne, wenn im Elektrizitätswerk plötzlich irgend etwas versagt. Ein Strom kalten Entsetzens schoss durch Peters Adern und schlug ihm ins Herz."
Im Unterschied zu Roth, der Wetter und Weltgeschichte sorgsam synchronisiert, kommt der meteorologischen bzw. astronomischen Bewegung im "Salz der Erde" aber keine echte dramaturgische oder symbolische Bedeutung zu. Wittlins Roman verzichtet auf kathartische Effekte, und die Sonnenfinsternis illustriert in erster Linie die Anfälligkeit der Menschen für Aberglauben und deren latente religiöse Hysterie: "Angst fiel über die ganze huzulische Erde, obgleich viele Huzulen wußten, dass das eine Sonnenfinsternis war."
Bei Roth ist Kaiser Franz Joseph ein müder und schon leicht seniler Greis, der sichtlich das Ende einer Epoche verkörpert. Bei Wittlin ist er eine Witzfigur. Vom Oberleutnant Leithuber, einem Mann von attraktivem Äußeren – "ein wenig Rom und ein wenig ,Alt-Wien'" –, heißt es am Ende des Romans, er repräsentiere "einen Typ, der in späteren Jahren bei der Filmindustrie sehr gesucht war".
Ähnlich verhält es sich mit seiner apostolischen Majestät, die von zwei neben ihr stehenden greisen Generälen nicht zu unterscheiden ist: "Alle drei trugen graue Backenbärte und waren einander ähnlich wie drei Briefmarken. Ein gemeinsames Leben, die gleiche Langeweile und die gleichen Freuden hatten ihnen das gleiche Aussehen gegeben."
Wittlin verfügt über einen schneidend sarkastischen und bösen Humor, das drei Jahre nach dem "Radetzkymarsch" erschienene "Salz der Erde" ist als Projektionsfläche für Habsburger-Nostalgie denkbar ungeeignet. Der Roman handelt denn auch nicht von einer "versunkenen Welt", der man wehmütig ein paar Tränen nachweinen könnte, sondern vom Krieg.
Man kann Wittlins Roman, der Roths Abgesang aufs Habsburger-Imperium gewiss in nichts nachsteht, diesem ästhetisch und analytisch eher überlegen, in jedem Falle "moderner" ist, durchaus als Anti-Kriegsroman klassifizieren. Er ist dies aber auf eine höchst bemerkenswerte Weise.
Im "Salz der Erde" werden keine Schützengräben ausgehoben, es fallen keine Bomben, es fällt nicht einmal ein Schuss, und das Blutvergießen, das stattfindet, wird nur dank des extremen Einsatzes von Zeitlupen- und Zoomtechniken registriert, deren sich Wittlin in dem furiosen Eingangskapitel bedient.
Als sich der Kaiser nämlich anschickt, endlich die Kriegserklärung zu unterfertigen, die ihm seine Generäle hingeschoben haben, kommt es zu einer kleinen Panne, die das Potenzial eines welthistorischen Ereignisses in sich trägt: Nachdem er den "Franz" aufs Papier gesetzt hat, versagt die Feder, der Kaiser ritzt sich mit der Feder in den Finger und aus diesem "quoll ein winziger Tropfen Blut".
Nur im Märchen erstarrt die Zeit, wenn sich Monarchen in den Finger stechen, und so geht alles seinen bekannt schrecklichen Gang, der rund 17 Millionen Menschen das Leben kosten wird. Um zu erzählen, wie es so weit kommen konnte, greift Wittlin zu einem genialen literarischen Kniff: Er macht den Bahnhofsvorstand von Topory-Czernielitza zum Helden seines Romans.
Dieser Peter Niewiadomski ist
41 Jahre alt, unverheiratet, kinderlos und ohne rechte Überzeugung und Freude mit einer Magd zusammen, für die er sich ein bisschen geniert.Er selbst ist Analphabet und sichtlich nicht das schärfste Messer in Gottes Bestecklade. Er ist nicht einmal sonderlich sympathisch und daher auch keine jener pikaresken Figuren zwischen Simplicissimus und Schweijk, die sich mit einer Mischung aus echter und vorgeschützter Naivität pfiffig durch das Grauen wursteln.
Die Figur des durchaus nicht reinen, sondern ressentimentbeladenen und abergläubischen Toren nutzt Wittlin, um die Absurdität des Kriegs zu demaskieren: Dass dieser ein Werk des Teufels sei – dessen Machinationen der Protagonist hinter allem vermutet, was ihm Angst einflößt –, ist nämlich mindestens genauso plausibel wie dass Menschen sich zu Soldaten machen lassen; oder um es mit den Worten von Stabsfeldwebel Bachmatiuk zu sagen, dessen Psychogramm der fulminante Analytiker Wittlin im neunten Kapitel erstellt: "Ich werde aus euch Menschen machen!"
Die Menschwerdung des Peter Niewiadomski, die hier in einer literarischen Achterbahnfahrt beschrieben wird und deren kalauernder Furor mitunter Elfriede Jelinek vorwegzunehmen scheint, gehört fraglos zum Aufregendsten, was die Literatur des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat. "Lesen! Und liegen Sie bequem!"