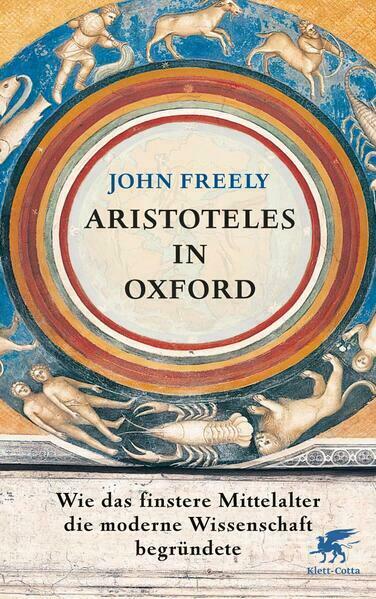Es begann schon 1000 Jahre vor Galilei
André Behr in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 47)
Wissenschaftsgeschichte: John Freely belegt, dass moderne Wissenschaft viel älter ist, als gedacht
Meist wenden sich Physiker der Geschichte ihres Fachs erst gegen Ende ihrer Karriere intensiver zu – wenn überhaupt. John Freely ist ein prominentes Gegenbeispiel für diese Regel. Geboren 1926 in Brooklyn, New York, misstraute der irischstämmige Amerikaner der damaligen Lehrmeinung bereits, als er seine durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochene Ausbildung wieder aufnahm.
Warum sollte die moderne Wissenschaft erst mit Galileo Galilei, der sich heroisch für das heliozentrische Weltbild des Kopernikus einsetzte, begonnen haben, fragte er sich. Lag das Abendland nach der griechischen Antike tatsächlich so lange im naturwissenschaftlichen Dunkeln, wie behauptet wurde?
Zurück von seinem zweijährigen US-Navy-Einsatz in Asien hatte Freely, knapp 20-jährig, am Iona College in New Rochelle ein GI-Stipendium erhalten und auf dem Campus gleich am ersten Tag die Statue des Columban von Iona entdeckt, des Schutzpatrons seiner Schule.
Dieser heiliggesprochene Klostergründer war im sechsten Jahrhundert einer der Protagonisten einer Bildungsoffensive gewesen. Schriften meist isoliert arbeitender Gelehrter wie Boëthius oder Cassiodor waren abgeschrieben und verbreitet worden, sodass immer mehr europäische Denker alte Werke studieren konnten, zumal im 12. und 13. Jahrhundert auch die ersten Universitäten Europas entstanden. In Wahrheit, das wurde John Freely bald klar, war nach dem Niedergang der römischen Klassik und dem verheerenden Brand der legendären Bibliothek von Alexandria nie alles Wissen verlorengegangen.
Dank eines feinen Ariadnefadens von Alexandria über das mittelalterliche Byzanz und die islamische Welt ist vieles überliefert worden, teilweise durch Übersetzungen vom Griechischen ins Aramäische, Persische, Arabische und endlich ins Lateinische.
Den "Ariadnefaden" wickelte Freely minutiös in seinem 2012 auf Deutsch erschienenen Buch "Platon in Bagdad" ab. In seinem neuesten Werk, "Aristoteles in Oxford", schildert er die Wissensentwicklung und -vermittlung von einem Forscher zum nächsten, die in Europa 1000 Jahre vor der Geburt Galileis ihren Anfang nahm. Es geht im Wesentlichen auf seine Zeit am All Souls College in Oxford zurück.
Dort war Freely Postdoktorand beim elf Jahre älteren australischen Mittelalterspezialisten Alistair Cameron Crombie, bevor er in Istanbul an der heutigen Bosporus-Universität selbst Professor wurde. Aufgrund der Forschungen Crombies hatte man Wissenschaftsgeschichte in Oxford überhaupt erst zum offiziellen Lehrfach erhoben.
John Freely beginnt seine Ausführungen mit einem Blick auf das Europa an der Wende von der Spätantike zum frühen Mittelalter, als mit der Plünderung Roms durch die Goten 410 die "Wirren und Wanderungen" einsetzten.
Ungemein detailreich und ausgestattet mit seinen über Jahrzehnte auf vielen Reisen selbst zusammengetragenen Quellen gelangt er im 17. Kapitel endlich zu Isaac Newton. Dessen Forschungen bilden den krönenden Abschluss der langen Reise durch Europa und weisen zugleich der Wissenschaftskultur, die wir als modern bezeichnen, den Weg.
Man findet auf dieser Reise viele Belege für Crombies und Freelys These, dass in der abendländischen Wissenschaft vom frühen Mittelalter bis Kopernikus, Galilei und Newton mehr Kontinuität auszumachen ist, als es Anhänger von Thomas Kuhns Konstrukt der "Paradigmenwechsel" glauben wollen.
Ein schönes Beispiel dafür ist das Kapitel "Die experimentelle Methode". Was heute zum Kanon einer nachhaltigen Theoriebildung gehört, geht auf Gelehrte wie den Franzosen Petrus Peregrinus zurück, den sein Schüler und Patron der "empirischen Methode" in der Philosophie, Roger Bacon, als "dominus experimentorum" bezeichnete und mit den Worten lobte, seine Wissenschaft sei "das Ende jeglicher theoretischer Argumentation".
Erstaunlich, wie "modern" Peregrinus das Phänomen des Magnetismus experimentell untersuchte. In seinem einzigen erhaltenen Werk, "De Magnete" von 1267, einer "Epistola", die er als Soldat im Heer des Königs von Sizilien während einer Belagerung verfasste, beschreibt er, wie er anhand eines kugelförmigen Magneten mithilfe einer Nadel die Existenz magnetischer Feldlinien nachweisen kann.
Darüber hinaus entdeckte Peregrinus die Polarität von Magneten und lieferte dank seiner innovativen Ideen im Instrumentenbau den ersten, allerdings noch nicht hinreichenden Entwurf für ein astronomisches Navigationsgerät.
Ohne Navigation überquert kein Schiff sicher die Ozeane. Im übertragenen Sinne darf man behaupten, dass auch niemand sicher durch die Wissenschaftsgeschichte kommt, wenn er nicht das fulminante Werk von John Freely liest.