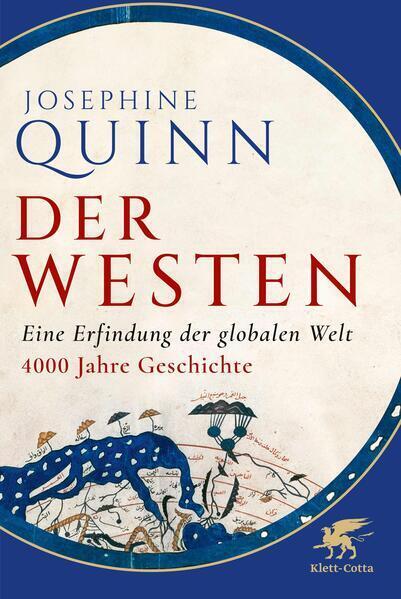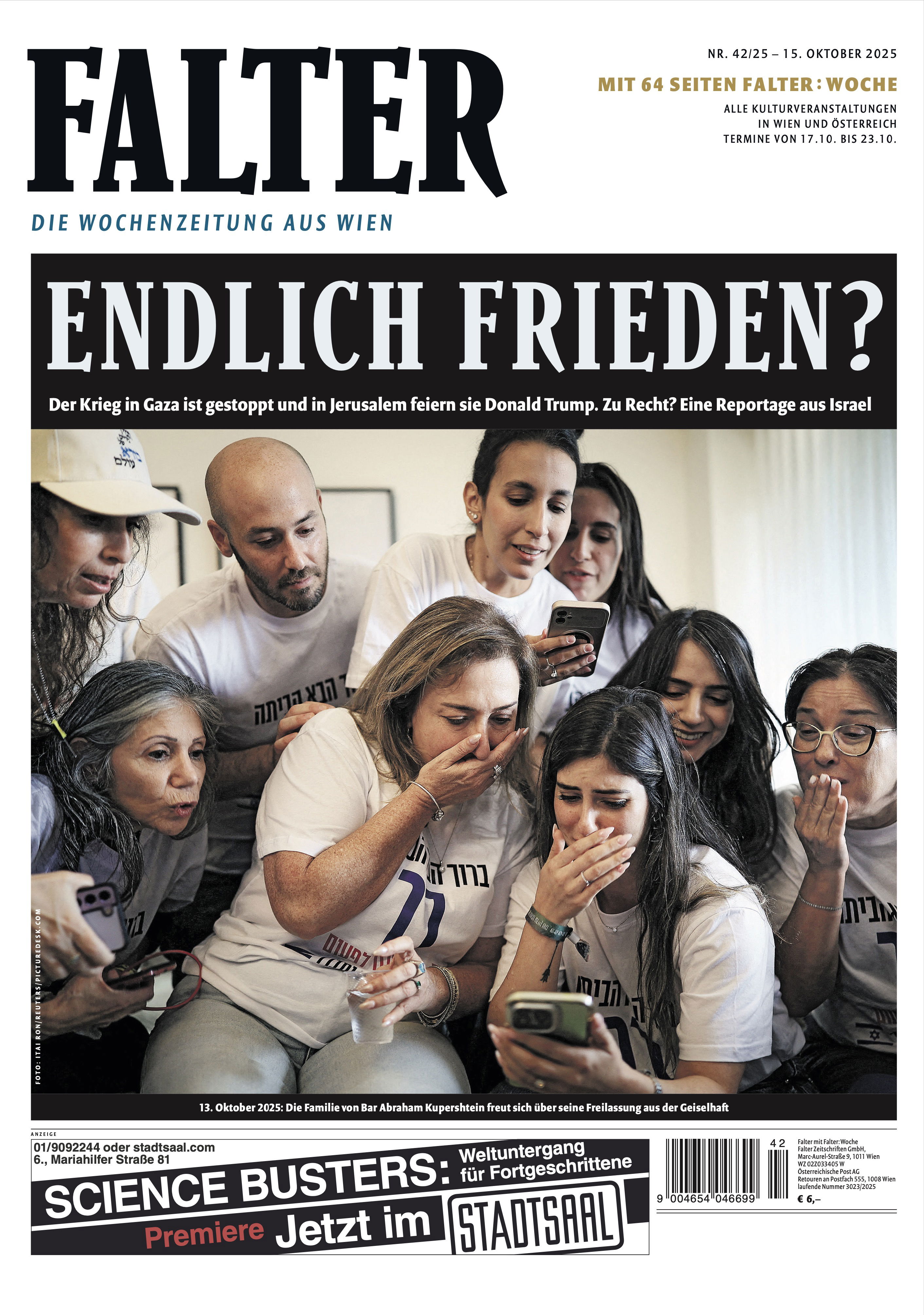
Globalisierung 0.0
Oliver Hochadel in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 41)
Abgesänge auf den Westen liest man heute täglich. Europa habe machtpolitisch abgedankt, das globale Machtzentrum liege künftig in Ostasien. Aber zuvor, das ist die nicht hinterfragte Annahme, war „der Westen“ der Impulsgeber der Weltgeschichte. „Unsere“ abendländische Kultur geht wiederum auf unser griechisch-römisches Erbe zurück, dem wir die Grundlagen der Demokratie, des Rechts, der Philosophie, Kunst und Literatur und auch des Imperiums verdanken. Noch so eine nicht hinterfragte Annahme.
Mit „Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt. 4.000 Jahre Geschichte“ meldet Josephine Quinn, Althistorikerin an der Universität Cambridge, fundamentalen Widerspruch an. In der deutschen Übersetzung ist der Titel etwas umständlich geraten. Der Originaltitel ist knackiger und klarer: „How the World Made the West. A 4,000-Year History“.
Nach dem Ende des Kalten Krieges ist die Globalgeschichte zu einem hippen Feld der Geschichtswissenschaft geworden. Die nationale Geschichtsschreibung trage Scheuklappen, nur durch einen umfassenden Blickwinkel ließen sich historische Prozesse verstehen. Schön und gut, sagt Quinn, nur beginnt Globalgeschichte stets mit der Entdeckung Amerikas und dem Entstehen der europäischen Kolonialreiche. So ist ihr Buch eine selbstgestellte Herausforderung: „Ich zeige euch jetzt mal, dass die Globalisierung schon 4000 Jahre früher losging.“ Quinn entfaltet ein beeindruckendes historisches Panorama von 2500 v. Chr. bis 1492, von der Bronzezeit bis zu Kolumbus, das neben Europa fast ganz Asien und große Teile Nord- und Westafrikas miteinbezieht. Also nicht die ganze Welt, aber sehr viel mehr als nur „der Westen“.
Quinns Buch ist eine lange Prozession von Stadtstaaten und Königreichen, kleinen und großen Imperien, Seefahrer- und Handelsvölkern. Sie tragen Namen, die oft nur noch Spezialisten kennen: Assyrer, Punier, Umayyaden, Etrurier, Ugarit, Skythen, Pontos, Parther, Garamanten. Dazu gesellen sich Hafen- und Oasenstädte mit enormer kultureller Ausstrahlung wie Tyros, Mykene, Palmyra, Thera, Karthago und Massalia, von denen heute meist nur wenige Ruinen zeugen.
Quinn zitiert auch DNA-Studien von Gräbern, die die hohe Mobilität der Bestatteten belegen, ebenso wie Isotopenanalysen, die etwa zeigen, dass Kupfer aus Zypern bereits im 16. Jahrhundert v. Chr. (!) bis nach Schweden gelangte. Auch wenn ihr Schwerpunkt auf dem Mittelmeerraum liegt, so erzählt Quinn doch auch von chinesischen Expeditionen gen Westen, der Bedeutung des Indischen Ozeans als Verkehrsader und Goldkarawanen durch die Sahara.
Fernhandel, blutige Kriege, Eroberungsfeldzüge und Migration verbreiteten neues Wissen und innovative Techniken in alle Himmelsrichtungen: Schrift- und Rechensysteme, Architektur, Keramik, Waffen- und Schiffsbautechnik, Landwirtschaft und Besteuerungssysteme.
Aber nicht nur Waren, Kapital und Technologien strömten durch die Alte Welt, sondern auch Geschichten. Homers „Ilias“ und „Odyssee“, die Urtexte abendländischer Literatur, stecken voller Motive und Narrative noch älterer Erzählungen. Aber „Austausch führt nicht zu unreflektierter Nachahmung“. Quinn identifiziert Imitation und kreative Adaption als entscheidende zivilisatorische Muster. Nicht zuletzt dank dieser Fähigkeit, sich alles Nützliche einzuverleiben, stieg Rom zur antiken Supermacht auf. Die Römer waren gerissene Raubkopierer. Sie verbesserten die Baupläne ihrer eigenen Flotte, indem sie erbeutete karthagische Schiffe studierten. Rom war „eine imperiale Metropole, in der es von ausländischen Kunstwerken und Ideen nur so wimmelte“. Römer zu sein war nie ethnisch gedacht, man musste nur dem Staat dienen. Als imperiale Kosmopoliten waren die alten Römer Integrationsweltmeister. „Wenn Römer von überallher kamen, dann gehörte alles zu Rom.“
Sehnsucht nach der Antike als „rassismusfreier“ Vorzeit kommt bei der Lektüre freilich nicht auf. Blutige Massaker, Massenversklavungen und die Auslöschung ganzer Kulturen gehören zum Soundtrack des Buches, das trotz seines flotten Stils angesichts der überbordenden Informationsflut gelegentlich auch ein paar Längen aufweist.
Unsere verzerrten Vorstellungen der Antike verdanken wir Denkern des 19. Jahrhunderts, die Griechenland und Rom als Grundpfeiler unserer Zivilisation ausmachten. Die westeuropäischen Nationalstaaten zimmerten sich eine passende Vorgeschichte zurecht, samt exklusivem literarischen Kanon, die sie dann „abendländische Kultur“ nannten. Im Gymnasium wurden fortan Latein und Griechisch unterrichtet und eben nicht Akkadisch, Aramäisch, Phönizisch oder das mykenische Schriftsystem Linear B. Die „klassische“ Antike war für europäische Gelehrte ein Selbstbedienungsladen, der Vor- und Feindbilder en masse bereithielt. Besonders beliebt: die identitätsstiftende Absetzung vom „Orient“, dem „Osten“, und dem „Islam“.
Der britische Philosoph John Stuart Mill etwa behauptete 1846, dass die Schlacht bei den Thermopylen (479 v. Chr., die Spartaner unterliegen heldenhaft den Persern; Kinogängern als blutiges Hollywood-Schlachtenspektakel „300“ bekannt) bedeutender für die britische Geschichte gewesen sei als jene von Hastings (1066, die Normannen erobern England). Für Mill retteten die Griechen in den Perserkriegen unsere westliche Zivilisation gegen den Ansturm der niederträchtigen Barbaren aus dem Osten. Nur: Die Thermopylen-Schlacht war nur eine unter vielen und sicherlich nicht die bedeutendste kriegerische Auseinandersetzung der Zeit, stellt Mythenjägerin Quinn klar.
Noch entscheidender aber: Die Vorstellung von „Westen“ und „Osten“ gab es in der Antike überhaupt nicht. Das Denken in entgegengesetzten Kulturen oder Kontinenten (Asien – Europa) war den Menschen seinerzeit völlig fremd. Damit hat Quinn ihre zentrale Botschaft gefunden. Das nationalistische 19. Jahrhundert war „beseelt vom Geist des kulturalistischen Denkens“, ein folgenreicher historischer Irrweg. „Nicht Völker machen Geschichte, sondern Menschen und die Kontakte, die sie untereinander herstellen.“
Quinn geht es also um mehr als nur um ein verzerrtes Bild der Antike. „Dem Denken in Kulturen wohnt die Annahme eines dauerhaften und bedeutsamen Unterschieds zwischen menschlichen Gesellschaften inne, die echten Schaden anrichtet.“ „Unsere“ Wurzeln aber sind zu vielfältig, „die Welt“ hat uns gemacht. Der westliche Chauvinismus gehört in die historische Abstellkammer.