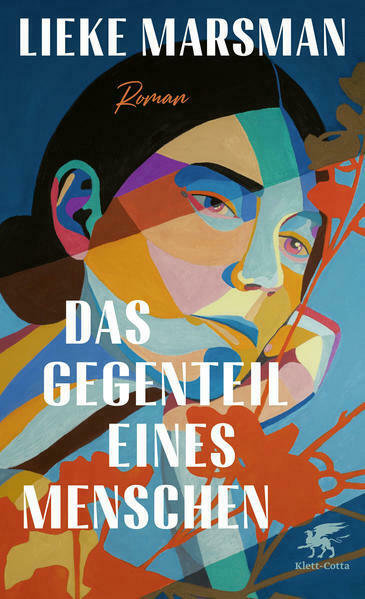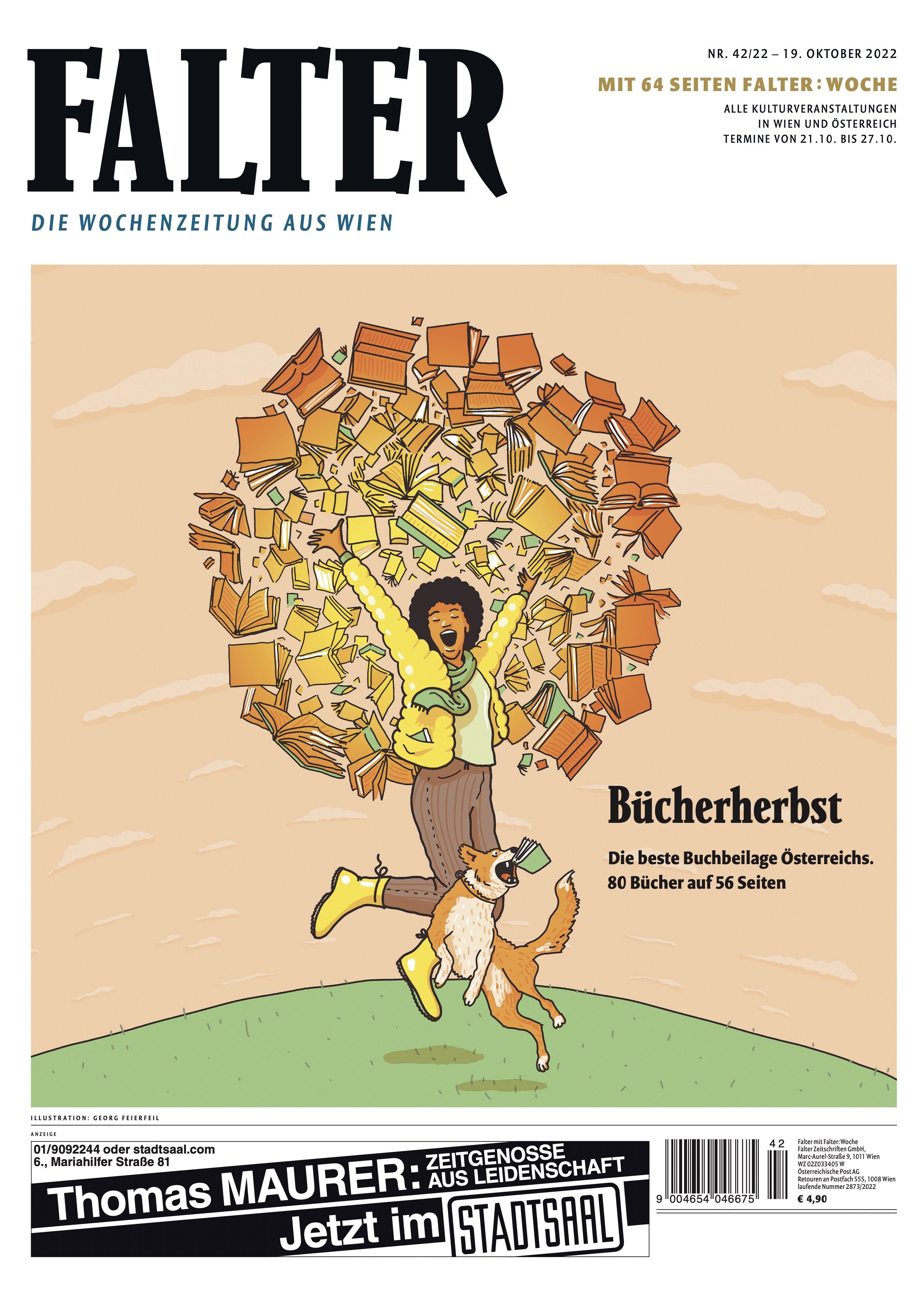
Immer forsch nach vorne!
Susanne Schaber in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 14)
Es beginnt ganz harmlos. Eines Nachts ist Simon verschwunden. Was ihm nicht ähnlich sieht. Dann kommt er nachhause zu seiner Freundin Leo, wirkt euphorisch und überdreht, berichtet von dubiosen Begegnungen und Projekten für eine strahlende Zukunft. In den nun folgenden Tagen und Wochen aber ist Simon nicht wiederzuerkennen: Er ist dünnhäutig, schläft kaum und schlittert in den Wahn, überwacht und in seinen Karriereplänen gehindert zu werden. Der vormals zarte Simon, für Leo ein Fels in der Brandung, rast ungebremst hinein in eine Psychose und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück. Die Situation eskaliert. Bis Leo schließlich kurze elf Minuten bleiben, um eine Tragödie zu verhindern.
„Ich bin nicht da“ nennt Lize Spit ihren zweiten Roman. Die 34-jährige Belgierin gilt seit Erscheinen ihres Erstlings „Und es schmilzt“ als Senkrechtstarterin. Über 200.000 verkaufte Exemplare, Auszeichnungen und Ausgaben in den wichtigsten Sprachen der Welt haben sie in die Top-Liga der flämischen Autorinnen katapultiert und ihren Ruf als literarische Grenzgängerin gefestigt, die Gefühle bis ins unerträglich Drastische hinein auslotet.
Angesichts des Erfolgs ihres exzentrischen Erstlings lag die Latte hoch. Und vielleicht hat sich Spit gerade deshalb neuerlich zu einem höchst dramatischen Stoff hinreißen lassen, einem filmisch gestalteten Psychogramm einer Beziehung mit gefährlich destruktivem Potenzial. Die Liebenden geraten in eine Horrorshow, als Simon immer tiefer in seiner Paranoia versinkt. Leo, ohnedies eine nicht eben in sich ruhende Persönlichkeit, deckt und beschützt ihren Freund bis hin zur Einweisung in die Psychiatrie. Nach der Therapie begleitet sie Simon bei der Rückkehr in den Alltag und muss zusehen, wie ihn die Krankheit einholt – und sie gleich mit. Die zwei sitzen gemeinsam in der Falle.
Lize Spit beherrscht ihr Handwerk, das ist offensichtlich, und sie hat in Helga van Beuningen eine souveräne Übersetzerin gefunden. Der Roman fährt so ziemlich alles auf, was in den Meisterklassen der Filmhochschulen in Sachen „Suspense“ gelehrt wird. Doch je weiter die Autorin ihren auf mehreren Erzählebenen dahinjagenden Thriller vorantreibt, umso stärker entgleitet er ihr, rauscht ungebremst dahin, ufert aus und verfängt sich in einer Abfolge ermüdender Details. Und auch die Sprache gerät außer Kontrolle, verrennt sich in verqueren Bildern. „Wir waren“, so Leo über die Statik ihrer Liebe, „die beiden schiefgesackten Säulen, die, sobald man sie aneinanderlehnte, fester stehen würden als eine unversehrte, für sich stehende Säule es je könnte.“ Und als Simon im Krankenhaus sediert dahinvegetiert, heißt es über ihn, er sei „schlaff und bleich wie eine Nudel, die eine Nacht in der Spülmaschine verbracht hat“. Na ja. Nach knapp 600 Seiten ist das furiose Finale fast schon ein Aufatmen: Geschafft!
Viel gewagt, zu wenig gewonnen: Das ist diesmal der Preis für den Mut zum Risiko. Sei’s drum. Die couragiertesten Stimmen der niederländisch-flämischen Literatur – und das ist in diesem Herbst gleich dreifach belegt – gehören jungen Frauen. Schriftstellerinnen wie Hanna Bervoets, 1984 geboren, oder Lieke Marsman, Jahrgang 1990. Sie geben Ton und Richtung vor: pfeifen auf die Empfindlichkeiten der Selbstbeschau, richten sich im Wildwuchs ein und werfen sich auf alles, was ihnen die gesellschaftlich brennenden Diskussionen zuspielen. Vor allem aber getrauen sie sich, Beherztheit und Tempo vorzulegen, auf die Gefahr hin, hochkant aus der Kurve zu fliegen.
Was Hanna Bervoets in ihrem Roman „Dieser Beitrag wurde entfernt“ vorführt: ein formal und sprachlich konzentriertes, kühnes und zugleich subtiles Buch über den Fluch der Social Media. Auf einer der international agierenden Plattformen wachen Content-Moderatoren darüber, welche Fotos und Videos gerade noch legal sind und welche entfernt werden müssen. Ein diffiziles Abwägen: Einem Pädophilen den Tod zu wünschen ist erlaubt, bei einem Politiker hingegen geht das nicht; Fotos aus dem KZ dürfen bleiben, sofern keine minderjährigen unbekleideten Opfer zu sehen sind. Porno, mit oder ohne Gewalt – sofort löschen. 500 Beiträge täglich, das ist die Marke, die es zu erreichen gilt, für jeden einzelnen Beschäftigten. Da muss man sich ranhalten.
Ein andauernder Angriff auf die Psyche. Kaum jemand verkraftet es auf Dauer, mit den verstörenden Bildern klarzukommen. Alkohol und Drogen werden dagegen aufgeboten oder exzessives Masturbieren wie bei der Ich-Erzählerin Kayleigh. Sie hat Schulden, der Job ist gut entlohnt. Wie teuer sie dafür bezahlt, will sie lange nicht wahrhaben. Zumal sie in jener Gruppe, der sie zugeordnet ist, Sigrid kennenlernt. Die zwei werden ein Paar. Doch unmerklich stellen sich bei Sigrid und den Freunden aus dem Team Veränderungen ein: ein Hang zu Esoterik und Heilslehren, gefolgt von höchst dubiosen politischen Aussagen.
Der schmale Band, eigentlich ein Brief an einen Anwalt, schildert packend, wie das Denken in seltsame Richtungen abbiegt – bis die Erde zur Scheibe geworden ist und die CIA uns wie Statisten in einer gigantischen Hollywood-Kulisse hin und her schiebt. Und der Holocaust ist ein Märchen. Hanna Bervoets beschreibt, wie subtil sich die Manipulationen der Sozialen Medien entfalten. Und selbst jene, die das Internet zensieren, verlieren jedes Maß für richtig und falsch. Womit das ohnehin schon fragile gesellschaftliche Wertesystem noch zerbrechlicher wird. Ein großes Thema, gebündelt in einem verhaltenen und gerade dadurch aufwühlenden Stück Literatur.
Um brüchige Wertesysteme kreist auch Lieke Marsmans Roman „Das Gegenteil eines Menschen“. Es ist die Geschichte einer jungen Klimatologin, die ihren Platz sucht in Zeiten, da die Menschheit auf den Abgrund zutaumelt. Zwischen Angst und Hoffnung bestehe kein Unterschied, so Ida: Beide haben mit Zukunft zu tun, und die bekomme man selten zu fassen. An guten Tagen glaubt sie mit ihren Daten und Tabellen mithelfen zu können, um einen Weg aus der drohenden Natur- und Nuklearkatastrophe zu finden, an schlechten steckt sie den Kopf in den Sand und schiebt die Schuld für ihren Fatalismus auf ihre Elterngeneration, die die Welt in jenen Zustand manövriert hat, an dem Ida so schwer trägt. Rettung ist keine in Sicht, die Politik versagt. Ida scheint jede Perspektive, die ihr unterkommt, „ein bisschen so wie das Wetter: heute ziemlich entscheidend für meine täglichen Aktivitäten […], morgen egal“.
Zwischen den Polen von Aufbruch und Resignation driftet die Ich-Erzählerin dahin, gefangen in den Zweifeln ob ihrer sexuellen Identität. Der Roman zeichnet diese Orientierungslosigkeit in kurzen Sequenzen und mit ständig neuen Wendungen nach. Der Text wirkt kursorisch, manchmal unfertig und vorläufig. Was Idas desperatem Denken und Tun entspricht. Ihr Schreiben avanciert zur Selbstanalyse. Dafür durchforstet sie das Netz und plündert Bibliotheken, schwingt sich zu philosophischen Diskursen auf, lässt Zitate, Gedichte und Tagebuchnotate einfließen. Es geht dabei kreuz und quer durch Wissenschaft, Literatur und Poesie, in einem breiten Bogen von Robert Creeley und Naomi Klein bis hin zu Blaise Pascal oder Anne Carson.
Das Konvolut an Schnipseln ist wild in den Text montiert, bricht ihn auf und bildet so die Ratlosigkeit der heute 20- und 30-Jährigen ab, die nicht wissen, woran sie sich halten sollen. „I am fluid“, wie Joni Mitchell sagt, „Everything I am, I’m not.“ Und selbst die Liebe ist kein sicherer Hafen, wenn das Lebensgefühl im Vagen wurzelt. Was sich zuspitzt, als Ida von ihrer Freundin verlassen wird. „Bin eine Gurke“, so ihr Mantra als kleines Mädchen: wächst, aber empfindet nichts. Eine Form der Kapitulation schon in jungen Jahren.
Marsman nimmt abgehobene Sujets eigen- und hintersinnig auf und holt sie auf den Boden. Ihr schmaler Band, den Christiane Burkhardt und Stefanie Ochel fein übersetzt haben, hat seine prätentiöse Seiten. Doch er ist ein Versprechen, weil er forsch nach vorne sprintet, vieles ausprobiert und sich den Bedrohungen durch Untergangsszenarien auf originelle Weise annähert.
Lieke Marsman, Lize Spit und Hanna Bervoets riskieren einiges, jede auf ihre Weise. Sie beweisen Mut und liefern damit etwas, was gerade in Tagen wie diesen nottut und überzeugt: eine Literatur, die sich exponiert.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: