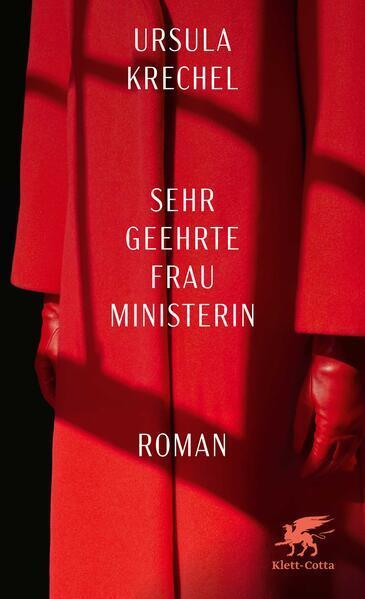Agrippina, Lateinlehrerin und Kräuterladenfrau
Jörg Magenau in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 14)
Die Sprache ist so etwas wie ein Eisenbahngelände. Die Satzteile verhalten sich wie Waggons, die aneinandergekoppelt, aber auch wieder getrennt werden können. So jedenfalls sieht es die Erzählerin in Ursula Krechels neuem Roman „Sehr geehrte Frau Ministerin“, eine Lateinlehrerin, deren Sprachempfinden offenbar vor allem durch die mechanistische Grammatik des Lateinischen geprägt worden ist. So verfährt aber auch Ursula Krechel selbst, deren jüngstes Werk wie ein Rangierbahnhof funktioniert, auf dem sie ihr Personal und ihre Themen hin und her schiebt.
Im ersten des in drei Teile gegliederten Romans geht es um eine eher durchschnittliche Frau namens Eva Patarak. Sie betreibt einen Kräuterladen in Essen, besucht mit anderen Frauen ein Fortbildungsseminar, verliert allerdings ihren Job, als das Geschäft an eine größere Kette verkauft wird. Das ist – inklusive der Exkurse über diverse Cremes, Kräuter und Diäten – ausgesucht langweilig.
Spannender könnte ein anderes Thema sein, das aber leider unausgeführt bleibt. Die Protagonistin lebt mit ihrem leicht übergewichtigen Sohn zusammen, der ihr ganz und gar fremd bleibt. Das Studium hat er geschmissen, um sein Leben ausschließlich in seinem Zimmer vor dem PC zu verbringen, das er allenfalls verlässt, um zum Kühlschrank zu gehen.
Computergestützte Lethargie, Erfahrungsmangel und physische Unbehaustheit in der digital überformten Wirklichkeit ist ein Massenphänomen gerade unter Jugendlichen, dem nachzugehen lohnend wäre. Doch Krechel interessiert sich für den monströsen Sohn nur im Zusammenhang mit dessen Mutter, weil sie ausschließlich auf Frauen und Formen weiblicher Abhängigkeit fokussiert.
Das begründet auch den Einschub langer Passagen über Kaiser Nero und seine Mutter Agrippina, die ihrem Sohn den Weg zur Macht ebnete, dann aber, selbst zu mächtig geworden, von diesem ermordet wurde.
„Die Frau ist lästig in der Geschichte, in jeder Geschichte, sie muss verschwinden“, lautet Krechels trivialfeministischer Lehrsatz, der für die römische Antike ebenso Geltung beansprucht wie für die Gesellschaft der Gegenwart.
Erzählt wird diese doppelte Mutter-Sohn-Konstellation von der erwähnten Lateinlehrerin Silke Aschauer, die nebenbei auch schriftstellerische Ambitionen verfolgt und – man weiß nicht so recht, warum – über die Frau im Kräuterladen schreiben möchte.
Dort tritt sie als „Frau mit der roten Mütze“ auf, unter der sie ihr infolge einer Chemotherapie kahl gewordenes Haupt verbirgt. Erst im zweiten Romanteil outet sie sich als Erzählerin und geht von der dritten Person zur Ich-Form über, durchaus elegant begründet mit Verweis auf die menschliche Entwicklung: Auch kleine Kinder sprächen zunächst von sich selbst in der dritten Person, und es dauert eine Weile, bis das tyrannische Ich die Herrschaft übernimmt.
Die Kräuterladenfrau entpuppt sich nun als Erfindung der Lateinlehrerin, als Fiktion in der Fiktion, spielt von da an aber nur noch eine Nebenrolle, weil es Silke Aschauer vor allem um sie selbst geht. Sie leidet unter heftigen Menstruationsbeschwerden, die schließlich eine Gebärmutterentfernung unumgänglich machen.
In diesen Passagen badet der Roman geradezu in Blut, mutiert zum Krankenreport und zur weiblichen Passionsgeschichte. Sind es bei Eva Patarak die gesellschaftlichen Bedingungen, der Kapitalismus und die familiäre Schieflage, unter denen sie leidet, so rebelliert bei Silke Aschauer der eigene Leib.
Doch damit noch nicht genug. Im dritten Teil rückt eine namenlos bleibende Justizministerin in den Mittelpunkt der sparsamen Ereignisse. Die Kräuterfrau hat sich brieflich an die Titelheldin gewandt, weil sie nicht möchte, dass über sie geschrieben wird.
Mit anderen Worten: Die Romanfigur beschwert sich hier über die (fiktive) Autorin. Das könnte eigentlich witzig sein, wirkt hier aber bloß ausgedacht – wie alles an diesem Romankonstrukt. Und früh ist zu ahnen, welches Schicksal die Autorin der Ministerin zugedacht hat – allzu offensichtlich ist ihre Absicht. Ursula Krechel sorgt sich um den Fortbestand des Rechtsstaates. Mit der zunehmend aggressiven Stimmung gegen Politiker greift sie ein aktuelles Thema auf und verschiebt es in den Kontext von Gewalt gegen Frauen. Auch die arme Ministerin steht in der Tradition der Agrippina.
Es gibt einige schöne Exkurse in diesem an Nebengleisen reichen Roman. So betrachtet Silke Aschauer im Wartezimmer der Gynäkologin das berühmte Gemälde eines anonymen Malers mit dem Titel „Gabrielle d’Estrées und eine ihrer Schwestern“. Auf diesem sind zwei porzellanblasse Frauen zu sehen, die nackt in einer Wanne sitzen, und die linke greift der rechten mit spitzen Fingern an die Brustwarze. Es könnte sich dabei um die Anspielung auf eine Schwangerschaft handeln; Gabrielle d’Estrées war die Geliebte Heinrichs IV.
Aschauers Überlegungen zu dem Bild sind anregend, doch kleine essayistische Perlen wie diese vermögen den Gesamteindruck nicht zu ändern: Während Teil eins und zwei noch einigermaßen stringent erzählt sind, zerfällt der dritte Teil in eine Überfülle von belanglosen Nebensächlichkeiten. Was haben etwa die kranichbeobachtenden Rentnern oder eine Gruppe von Anglern und Tauchern hier zu suchen, die in einem See einen versunkenen PKW entdecken? Das Ausgangsthema Mütter und Söhne ist dabei längst verlorengegangen, die These, dass Frauen aus der Geschichte verschwinden müssen, bis zum Überdruss durchdekliniert.