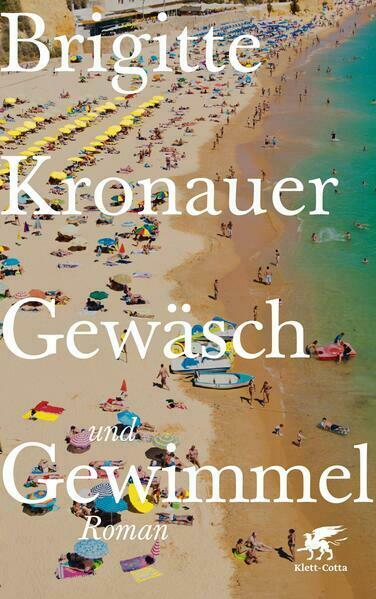Frau Brigittes verwilderter Garten
Tobias Heyl in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 24)
In ihrem jüngsten Roman erschöpft Brigitte Kronauer ihre Leser auf das Allererfreulichste
Man kann sich den neuen Roman von Brigitte Kronauer wie einen verwilderten Garten vorstellen: an den Seiten zwei Beete, in denen die Natur vor sich hin wuchern darf, in der Mitte ein Beet, das wenigstens Ansätze gärtnerischer Bemühungen erkennen lässt. Diese drei Beete entsprechen den drei großen Teilen, aus denen sich dieser mächtige Roman zusammensetzt, der auf einen so irritierend leichten Titel hört: "Gewäsch und Gewimmel".
Man überblickt ihn am besten von der Mitte, vom leidlich gepflegten Beet aus. Dort wuchert die Geschichte der Luise Wäns, einer alten Dame, die vor den Toren Hamburgs, am Rande eines Landschaftsschutzgebiets, wohnt. Sie erinnert an jene rüstigen Pensionistinnen, die zu früher Stunde mit einem altmodischen Regenmantel und einem Rucksack ausgerüstet zu einer Wanderung durch ihr Revier aufbrechen, die jeden Pilz, jede Pflanze mit Namen ansprechen und die Vögel an ihrem Gesang erkennen.
Frau Wäns' Revier ist ein Biotop, um dessen Renaturierung sich eine Gruppe von Bürgern unter der Leitung eines gewissen Hans Scheffer kümmert – und der wird ihr zum Schicksal: Sie ist ein bisschen verliebt in ihn, nicht mehr, als es sich für eine Dame dieses Alters gehört. Aber eines Tages steht er mit ihrer Tochter Sabine vor der Tür und die beiden verkünden, dass sie heiraten werden.
Das ist dann doch ein bisschen viel für Frau Wäns, obwohl sie sich für ihre Tochter natürlich freut, denn die hat vor Jahren ihren Sohn verloren und es gab Grund genug, sich wegen ihrer Depressionen Sorgen zu machen. Aber ist Hans Scheffer wirklich der Schwiegersohn, den man sich wünscht? Ein bisschen seltsam ist er ja schon, und was hat man eigentlich von seinem Verhältnis zu Adana zu halten, jenem Naturkind, das er aus Alaska in die norddeutsche Tiefebene lockte, von der sie sich freilich nach kurzer Zeit in Richtung Osten verabschiedet?
Das breite Publikum, schreibt der Dichter Pratz in sein Tagebuch, wolle unbedingt sogenannte richtige Geschichten. Der gemeine Leser toleriere eher, "dass sich jemand hundert Seiten lang mit jedem Schatten und Lächeln und Gedankenanflug an Ereignisse seiner Jugend erinnert als den Gewittersturm sporadischer Epiphanien".
In diesem Zitat darf man im Dichter Pratz wohl das Alter Ego der Autorin Kronauer erkennen: Denn wer "richtige" Geschichten sucht, findet sie bei ihr nur mit Mühe, wird stattdessen aber Zeuge literarischer Epiphanien sonder Zahl.
Die Geschichte der Frau Wäns und des Herrn Scheffer kommt noch am ehesten dem Bedürfnis nach einer "richtigen" Geschichte entgegen, aber sie ist eingewachsen von den beiden Nachbarteilen, in denen es von Figuren und Dialogen, von Rätseln und Beobachtungen nur so wimmelt, eine erzählerische Entropie, in der man verloren wäre, könnte man sich nicht an Elsa Gundlach halten, die in Hamburg als "Krankentherapeutin", als Physiotherapeutin, praktiziert – und in deren Wartezimmer sich regelmäßig ein großer Teil der Figuren trifft, von denen dieser Roman in hunderten Partikeln erzählt: Herr Brück, der Hundenarr, und die kleine Ilse, Herr Fritzle, den Rosen und dem Schach verfallen, die Herren Sykowa und Wind, der Pechvogel Alex und die schweigsame Eva, der Dichter Pratz und nicht zuletzt Frau Wäns. Sie ist Frau Gundlachs Lieblingspatientin, und schon deshalb ist ihr und ihrer Begegnung mit Hans Scheffer der große Mittelteil dieses epischen Triptychons vorbehalten.
Manchmal, wenn Frau Gundlach nachts nicht schlafen kann, gehen ihr die Geschichten ihrer Patienten durch den Kopf und aus diesen Wachträumen und Assoziationen erhebt sich ein Gewäsch und ein Gewimmel, dass es eine Art hat.
Aus kleinen Geschichten und Anekdoten, Rätseln, Briefen und Dialogen wuchert Seite für Seite eine ganze Welt. Man kann diese kleinen Stücke für sich studieren, so wie man sich bückt, um eine Blume zu bewundern. Zu finden sind da einige Meisterwerke der Prosaminiatur, auf Augenhöhe mit Johann Peter Hebel, Robert Walser oder Botho Strauß. Brigitte Kronauer braucht manchmal nur ein oder zwei Sätze, um eine charakteristische Szene aufzubauen, sie spielt mit Klang und Rhythmus der Sprache, verliert sich dabei aber nie im Kunsthandwerklichen oder Ornamentalen, weil sie genauso die Kunst der radikalen Reduktion beherrscht: "Der kleinen Ilse, die ein schüchternes, nur beim Theaterspielen merkwürdig grausames Kind ist, tut kein Mensch was. Sie ist einfach zu dünn." Knapper lässt sich ein Abgrund an Elend nicht vorstellen.
Nun kann man dieses Buch aber auch aus der entgegengesetzten Perspektive betrachten, als ein großes Prosapatchwork, in dem sich die Details der einzelnen Elemente verlieren. Die Erzählungen breiten sich in alle Richtungen aus, lassen sich nicht auf einen Erzählstrang bringen. Nur den Damen Gundlach und Wäns, die mit allen Figuren irgendwie bekannt sind, ist es zu verdanken, dass das Gewimmel der Ereignisse nicht völlig außer Kontrolle gerät.
Ein solches Erzählen widerlegt die Vorstellung, Geschichten bräuchten einen irgendwie logischen Verlauf und dazu einen Anfang und ein Ende, um sich aus dem Gewäsch und Gewimmel der Zeitläufte abzuheben. Kronauer lässt unzählige Geschichten nebeneinander wuchern, verbindet sie mal hier, mal da, züchtet Ableger, gönnt einer Figur einen großen Auftritt, um sie dann in der Versenkung verschwinden zu lassen – vielleicht für immer.
So entsteht eine Prosa, von der man manchmal nicht weiß, ob sie nun geschrieben oder geträumt ist, ein Universum im Kleinen wie im Großen, eine Herausforderung für den Kopf und für die Sinne: ein Roman, der den Leser im Zustand erschöpfter Zufriedenheit zurücklässt. Ins Regal stellen will er ihn nach so vielen gemeinsam verbrachten Stunden noch lange nicht.