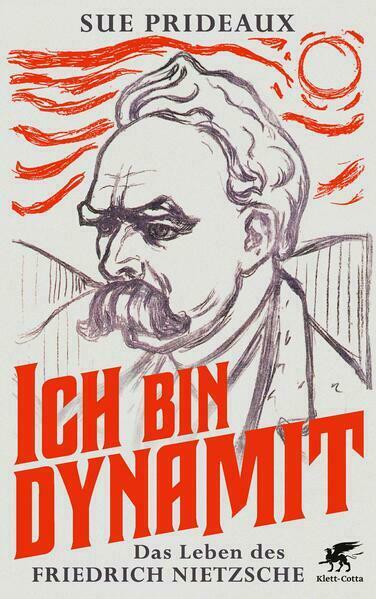„Lieber, halbblinder Professor“
Kirstin Breitenfellner in FALTER 11/2020 vom 11.03.2020 (S. 38)
Philosophie: Sue Prideaux erzählt das Leben von Friedrich Nietzsche (1844–1900) packend nach
Wer Nietzsche sagt, denkt an den Nationalsozialismus: So sehr haben sich Begriffe wie „blonde Bestie“, „der Wille zur Macht“ und „Übermensch“ mit der sozialdarwinistischen Blut-und-Boden-Ideologie Adolf Hitlers verbunden. Dabei war dieser Konnex das Werk von Nietzsches Schwester Elisabeth, die die „Umwertung aller Werte“ ihres Bruders derart manipulierte, dass sie zur finstersten Ideologie des 20. Jahrhunderts zu passen schienen. Aber Hitler konnte trotz seiner Verehrung für dessen Schwester mit Nietzsche „nicht viel anfangen“, referiert Sue Prideaux in ihrem Buch „Ich bin Dynamit. Das Leben des Friedrich Nietzsche“. Der Nazi-Ideologe Ernst Krieck fasst den Grund dafür plausibel zusammen: „Nietzsche war Gegner des Sozialismus, Gegner des Nationalismus und Gegner des Rassegedankens. Wenn man von diesen drei Geistesrichtungen absieht, hätte er vielleicht einen hervorragenden Nazi abgegeben.“
Prideaux’ packende Nacherzählung des Lebens des nichtsdestotrotz radikalen Philosophen kommt erst zum Schluss auf dieses Thema zu sprechen. Sie lässt die Handlung mit jenem Abend beginnen, an dem Nietzsche Richard Wagner kennen lernte, der bald zum angebeteten Freund avancierte, aber im Laufe der Jahre zunehmend als Rivale und schließlich als Hindernis wahrgenommen werden sollte. Nach seinem psychischen Zusammenbruch im Alter von 44 Jahren sollte Nietzsche Wagners Frau Cosima als seine Geliebte und Gattin bezeichnen.
Nach diesem Auftakt hält sich Prideaux treu an die chronologische Reihenfolge, beginnend mit der Kindheit in bürgerlichen, aber engstirnigen Verhältnissen (der Vater, ein Pastor, starb mit nur 35 Jahren – die damalige Diagnose lautete „Gehirnerweichung“) und der Internatszeit in der Eliteschule Pforta im sächsischen Naumburg. Was Nietzsche hier über Hölderlin schrieb, lese sich „wie ein versteckter Hinweis darauf, er selbst könnte bereits halb in den Gedanken verliebt sein, seinen Verstand hinzugeben, wenn sich denn dadurch das Tor zur Erleuchtung öffnen ließe“, meint Prideaux.
Geschehen sollte dies analog zu einer Szene in Dostojewskijs Roman „Schuld und Sühne“ (heute: „Verbrechen und Strafe“) von 1866: überwältigt von Mitleid mit einem schlecht behandelten Gaul im italienischen Turin. Dass die Ursache für Nietzsches Zusammenbruch, nach dem er die restlichen elf Jahre seines Lebens in geistiger Umnachtung verbringen sollte, eine Syphilis-Ansteckung war, sei historisch nicht gesichert, meint Prideaux. Dabei gehörte diese „Tatsache“ seit Thomas Manns Künstlerroman „Doktor Faustus“ (1947), der für die Vita seines Protagonisten, des Komponisten Adrian Leverkühn, Anleihen bei der Biografie Friedrich Nietzsches genommen hatte, sozusagen zur Allgemeinbildung.
Mit nur 24 Jahren wurde Nietzsche 1869 als jüngster Professor für Philologie nach Basel berufen, wo er zehn Jahre lang durchaus erfolgreich lehrte. Darauf folgten zehn sogenannte Wanderjahre, in denen er einen Großteil seines Werks schuf. Obwohl für seine Kreise nicht wohlhabend, konnte Nietzsche reisend und bergsteigend durch halb Europa tingeln, ohne etwas anderes zu tun als zu lesen und zu schreiben. Erfolg hatte er mit Letzterem keinen. Prideaux beschreibt seine Freundschaften und Beziehungen, allen voran jene zu Wagner, dessen Landsitz in Tribschen am Vierwaldstätter See für Nietzsche drei Jahre lang zu seiner „Insel der Seligen“ wurde. Erst mit dem Umzug Wagners nach Bayreuth setzte nach und nach Entfremdung ein.
Nietzsche war von Kindesbeinen an von Schlafstörungen, Erregungszuständen, Kopfschmerzen und Erbrechen geplagt, verbrachte mit zunehmendem Alter oft größere Teile des Jahres im Bett und ging nur mit grüner Brille und schnabelförmiger Schirmmütze aus dem Haus. Den Rest seines Gesichts versteckte der fotoscheue Philosoph unter dem berühmt-berüchtigten Schnurrbart. Prideaux beschreibt ihn als sanften, umgänglichen, gepflegten, humorvollen Zeitgenossen, den man „lieben, halbblinden Professor“ nannte. Seine Philosophie hingegen kannte keine Zurückhaltung, wovon einige seiner bekanntesten Aphorismen zeugen, etwa „Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“ oder „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, aber auch der vollmundige Untertitel von Nietzsches Autobiografie „Ecce Homo“ von 1888/89: „Wie man mit dem Hammer philosophiert“.
Das philosophische Werk wird in dieser Biografie jeweils nur kurz angerissen, und auch mit kulturhistorischer Kontextualisierung und psychologischen Spekulationen hält sich Prideaux zurück. Auf diese Weise entsteht zeitweilig der Eindruck, einen Roman zu lesen – und tatsächlich wurde das Buch 2019 mit dem Hawthornden-Preis, dem ältesten Literaturpreis Großbritanniens, ausgezeichnet –, aber einen Roman, der versucht, sich auf die Tatsachen zu beschränken, und damit anscheinend eine Gegenthese bildet zu Nietzsches Diktum aus den „Nachgelassenen Fragmenten“: „Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen.“
Aber die norwegisch-britische Autorin, die bereits Biografien über Edvard Munch und August Strindberg vorlegte, hat damit trotzdem einen Schlüssel gefunden, Nietzsches Denken in ihrer Lebensbeschreibung gerecht zu werden. Denn der Philosoph weigerte sich, obwohl er unter zunehmend krankhaftem Größenwahn litt, bis zum Schluss, ein geschlossenes philosophisches System vorzulegen. Aus seiner Überzeugung, alle Wahrheit sei nichts als persönliche Interpretation, ließ er Bücher auch schon mal mit einem fragenden „Oder?“ enden und überließ somit dem Leser die Deutung. Auch aus diesem Grund sei Nietzsches Vereinnahmung für die nationalsozialistische Ideologie als „groteske Fehlinterpretation“ zu werten, meint Prideaux. Nietzsche war nicht nur Antinationalist, Verächter des Antisemitismus und radikaler Antikleriker, ein glühender Europäer, der es vorzog, sich eine Herkunft aus den polnischen Adel anzudichten, um kein Deutscher sein zu müssen, sondern seit der Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 auch Antibellizist.
Am stärksten zu Herzen geht an seinem monströsen Leben nicht nur sein Ende als enthemmtes, brüllendes, kotschmierendes, von seiner Schwester zur Schau gestelltes Wesen, sondern auch die zunächst enervierende und zuletzt schockierende Beziehung zu ebendieser. Gegen Ende gerät „Ich bin Dynamit“ (der Titel ist übrigens ebenfalls ein Zitat aus „Ecce Homo“) unweigerlich zur Doppelbiografie, die dem unkonventionellen Leben und dem innovativen, epocheprägenden Geist von Friedrich Nietzsche Elisabeths ignorante, von keinerlei Selbstzweifeln angekränkelte, aber mit demselben Geltungsdrang ausgestattete autoritäre Persönlichkeit gegenüberstellt.
Elisabeth besaß eine stupende Fähigkeit zu Manipulation und Propaganda. Sie heiratete den politischen Agitator und Antisemiten Bernhard Förster und zog mit ihm nach Paraguay, um dort die Kolonie „Nueva Germania“ zu gründen. Nach deren Scheitern und dem Selbstmord Försters widmete sie sich mit ganzem Einsatz der Edition und der Entstellung des Werks ihres Bruders, des Philosophen des „Vielleicht“, der nichts mehr hasste als Neid, Ressentiment und Engstirnigkeit. Sie wurde dafür sogar zweimal für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen – ein Treppenwitz der Geschichte.
Zum Schluss dieses so atemberaubenden wie verstörenden Parforceritts durch ein außergewöhnliches Leben, das, obwohl er Nietzsche-Kennern vielleicht nichts Neues bietet, ein zentrales Kapitel europäischer Kulturgeschichte anschaulich macht, stehen ausgewählte Nietzsche-Aphorismen. Sie wecken den Wunsch, auch das Werk besser zu verstehen. Und sich dazu etwa Rüdiger Safranskis zum 100. Todestag im Jahr 2000 erschienene Monografie „Friedrich Nietzsche. Biographie seines Denkens“ vorzunehmen.