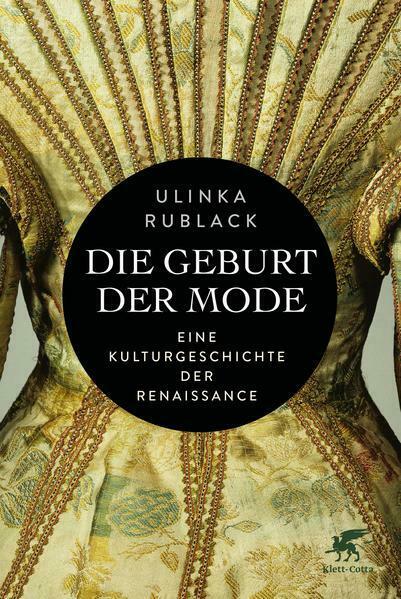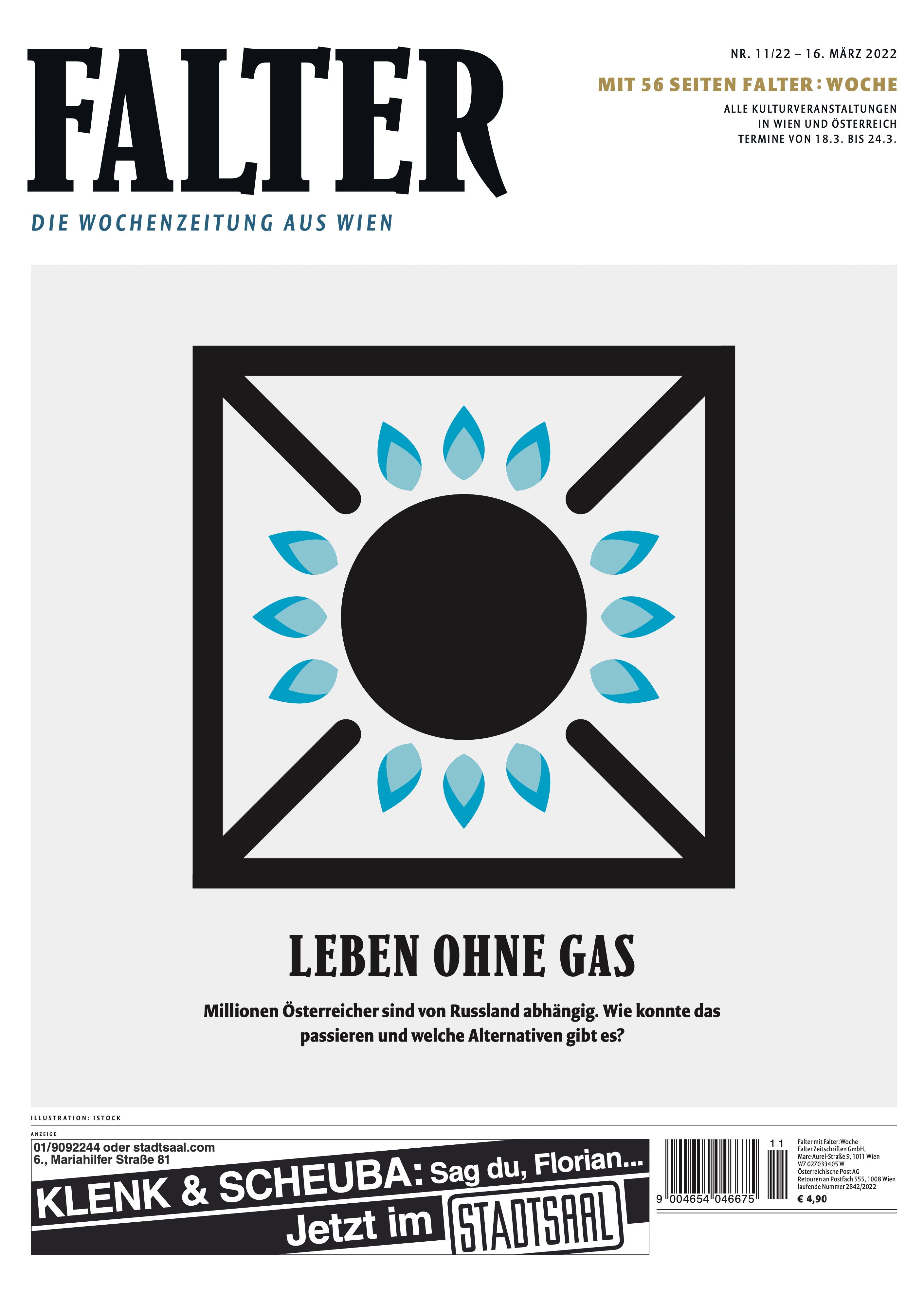
Über Schamkapseln und geschlitzte Wämser
Nathalie Grossschädl in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 44)
Im Pariser Louvre hängen zwei Ölporträts nebeneinander. Auf einem ist der deutsche Maler Albrecht Dürer zu sehen, auf dem anderen der Buchhalter Matthäus Schwarz aus Augsburg, ein echter Mode-Influencer seiner Zeit.
Beide Männer sind auf den Gemälden Ende 20, beide Bilder entstanden Ende des 15. Jahrhunderts und könnten unterschiedlicher nicht sein. Dürer ist auf seinem Selbstbildnis ungekämmt, exaltiert mit langen Haaren und auffälliger Kopfbedeckung. Schwarz hingegen, eine lokale Größe, ließ sich als stilbewusster Geschäftsmann mit eleganter Kleidung, exquisitem Schmuck und edlen Waffen in Szene setzen. So also wollten Männer Ende des 15. und im 16. Jahrhundert von der Welt gesehen werden, schließt die Historikerin Ulinka Rublack daraus.
Der lateinische Begriff „Modus“ mit Bezug zur Mode taucht erstmals im 15. Jahrhundert auf. In der Renaissance begann sich der Geschmack schneller zu ändern als je zuvor. Steigende Urbanisierung, das Entstehen handwerklicher Manufakturen, Kreuzzüge und dass die geistliche Elite begann, sich auszustaffieren – all das ließ Mode entstehen.
Rublacks gelungenes Buch „Die Geburt der Mode“ darf man getrost einen dicken Wälzer nennen. Die 530 Seiten sind gefüllt mit unterhaltsamen Geschichten über Menschen und ihre modischen Anstrengungen, garniert mit reichlich Anschauungsmaterial und einer umfangreichen Bibliografie. Rublack konzentriert sich auf die Analysen süddeutscher, vor allem Nürnberger und Augsburger Quellen.
„Dressing Up. Cultural Identity in Renaissance Europe“ heißt die Originalausgabe – die deutsche Autorin hat einen renommierten Lehrstuhl an der Universität Cambridge in England inne. Die preisgekrönte Frühneuzeit-Forscherin rollt die Geschichte der Mode nicht nur anhand der Porträts auf, sondern vor allem mithilfe des sogenannten Trachtenbuchs des narzisstisch veranlagten Matthäus Schwarz.
In seinem „Klaidungsbüchlein” dokumentierte Schwarz, Hauptbuchhalter der Fugger in Augsburg, sein komplettes Leben anhand seiner Outfits. Ab seinem 23. Lebensjahr beauftragte der pflichtbewusste Angestellte regelmäßig Künstler, ihn zu malen, wenn er ein paar schicke neue Kleider bekam.
Diese 173 Miniporträts auf Pergament arbeitete er in sein Büchlein ein und kommentierte sie. Für die Nachwelt zeigte er zum Beispiel, wie er sich für gesellschaftliche und politische Anlässe in Schale warf, etwa wenn er einen Karrieresprung vorhatte. Sein ganzer Dandy-Stolz war ein Wams mit 4800 Schlitzen. Der letzte Schrei damals! Diese Mode ging von den Landsknechten aus, deren Kleidung bunt war. Erstmals entwickelte sich Mode „von der Straße“ und nicht nur von den Höfen.
In der Renaissance dominierte italienische Mode, da italienische Städte wie Mailand, Florenz und vor allem Venedig wichtige Umschlagplätze für den Handel mit dem Orient wurden. Ganz Europa folgte der Renaissance-Mode. Die von Männern getragene Schamkapsel, entstanden aus dem Latz der Männerhosen, war eine Art Wonderbra für Männer und hatte interessante Formen angenommen. Männer fühlten sich dank ihr zu Vergleichen bemüßigt. Verständlicherweise war nicht jeder ein Freund der Schamkapsel. Der modische Mann trug sie über dem Wams, einer kurzen, schmalen Weste.
Amüsant veranschaulicht die Autorin in ihrer gesellschafts- und kulturgeschichtlichen Betrachtung, wie durch Bildmedien und durch den Austausch mit anderen Kulturen und Mentalitäten die Einstellung zum Konsum von Kleidung Teil einer umfassenderen Lebensanschauung wurde. Am Ende schreibt sie treffend: „Idealerweise konnte ich meinen Lesern hoffentlich ein Verständnis davon vermitteln, warum wir behaupten können, dass Kleider Geschichte schrieben und es in der Geschichte um Kleidung gehen kann.“