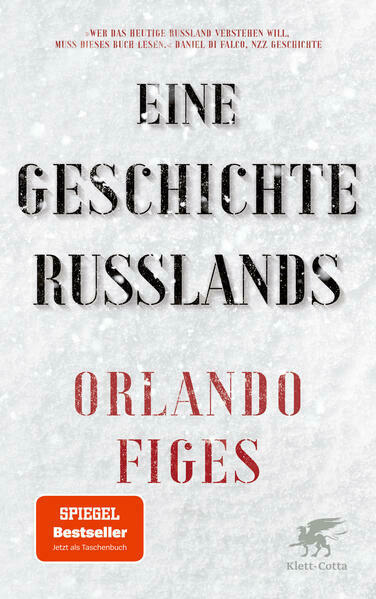In der Wiederholungsschleife der Geschichte
Kirstin Breitenfellner in FALTER 46/2022 vom 16.11.2022 (S. 20)
Wer Wladimir Putins Absichten verstehen will, muss die Geschichte Russlands kennen, sagt Orlando Figes. Und legt nach atemberaubenden Werken zur russischen Kulturgeschichte, zur Epoche der Revolution oder zum privaten Leben in der Stalin-Zeit nun eine historische Gesamtdarstellung bis zum beginnenden Ukraine-Krieg vor. Das englische Original ging vor ein paar Monaten in Druck, trotzdem hat das letzte Kapitel nichts an Bedeutung eingebüßt, denn der Ausgang des Krieges ist immer noch ungewiss. Während viele der derzeitigen Neuerscheinungen das "System Putin" zu erläutern versuchen, betont Figes, dass sich dieses nicht allein anhand der Machenschaften eines einzigen Mannes verstehen lasse. Zudem sei es zu großen Teilen bereits in den Jelzin-Jahren entstanden. Um die Entwicklungen in Russland zu begreifen, müsse man noch viel weiter zurückgehen.
Geschichte sei in Russland politisch, lautet Figes' Hauptthese. Kein anderes Land habe seine eigene Geschichte so häufig neu erfunden. Der Professor für neuere und neueste russische Geschichte am Birkbeck College an der University of London beginnt deswegen ganz von vorne. Und das heißt in dem Gebiet, in dem Weißrussen und "Kleinrussen", also Ukrainer, leben, von denen der Kreml überzeugt ist, dass sie ursprünglich zusammen mit den Russen eine Nation gebildet hätten. Es sei absurd, diagnostiziert Figes, zu behaupten, die Kiewer Rus des neunten Jahrhunderts sei der Geburtsort des modernen russischen Staates gewesen. Tatsächlich sei sie aber Teil der alten Geschichte Russlands.
Indem er diese nacherzählt, versucht er, deren Mythen "von ihrer Hülle zu befreien": die russische Seele, Moskau als drittes Rom, das "heilige" Russland sowie den Zaren als Väterchen und Führer, das heißt die Sakralisierung von Macht. Russlands autokratische Tradition mit vom Herrscher vollständig abhängigen Oligarchen sieht Figes als Vermächtnis der Mongolenherrschaft; die Ursprünge der Konzentration auf das Kollektiv und das große Durchhaltevermögen der Menschen verortet er in der Bauernkultur. In seinem Durchschreiten der Jahrhunderte nimmt er immer wieder direkt Bezug auf Ideen und Praktiken Putins.
Das durch den Zusammenbruch der Sowjetunion entstandene Vakuum sei mit Versatzstücken aus jeder Phase der Geschichte gefüllt worden. Diese eklektizistische Haltung, die auch die Sowjetzeit und sogar Stalin selbst mit einschloss, habe eine toxische Gemengelage aus Führerkult, Korruption, "großrussischem" Nationalismus und einer schwachen Zivilgesellschaft entstehen lassen. Gemeinsam mit dem wiedererwachten, jahrhundertealten Konkurrenzverhältnis zum Westen bilde sie die Grundlage für den von Putin als notwendig empfundenen Krieg gegen die Ukraine. Eine unaufhaltsame Entwicklung? Figes betont, dass Putin anfangs eine enge Beziehung mit dem Westen angestrebt habe. Für deren Scheitern sieht er die Ursache nicht nur bei Russland, sondern etwa auch in der Nato-Osterweiterung.
Figes' so sachliche wie spannende "Geschichte Russlands" macht klar, inwiefern Putin mit dem Krieg gegen die Ukraine zum "Opfer seiner eigenen Mythen von der ,russischen Welt'" geworden ist. Sie schließt mit einer finsteren Diagnose: "Es ist ein unnötiger Krieg, geboren aus Mythen und Putins verdrehter Deutung seiner Landesgeschichte. Wenn er nicht bald beendet wird, wird er das Beste an Russland zerstören; jene Teile seiner Kultur und Gesellschaft, die Europa seit tausend Jahren bereichern. (...) Russlands Zukunft ist ungewiss, aber eines steht fest: Seine Geschichte wird nie wieder die gleiche sein."