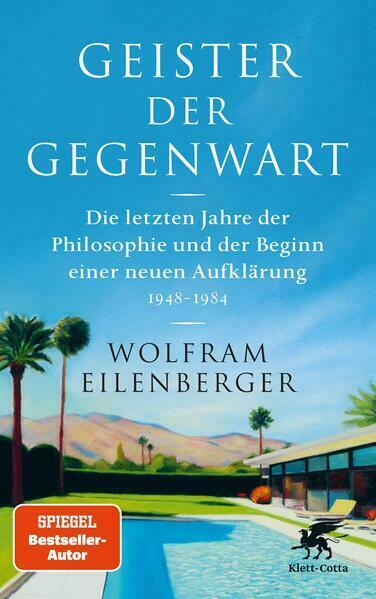Gegen eine Ordnung des Denkens
Kirstin Breitenfellner in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 37)
Am Anfang von Wolfram Eilenbergers neuem Buch „Geister der Gegenwart“ steht das Herrenfinale von Ivan Lendl gegen John McEnroe der French Open aus dem Jahr 1984. Nach erzählenden Sachbüchern über vier Philosophen und vier Philosophinnen unter den Titeln „Zeit der Zauberer“ und „Feuer der Freiheit“ legt der Bestsellerautor nun so etwas wie ein gemischtes Doppel vor: einen Parcours durch die Nachkriegsphilosophie anhand von Theodor W. Adorno, Paul Feyerabend, Michel Foucault und Susan Sontag. „Die letzten Jahre der Philosophie und der Beginn einer neuen Aufklärung. 1948–1984“ lautet der Untertitel.
Wie in den Vorgängerbüchern verschränkt Eilenberger dabei Leben und Schriften seiner Protagonisten und Protagonistinnen auf gekonnte Weise – und spart auch nicht mit Details aus deren Privat- und Liebesleben. Auf diese Weise erhalten seine Ausführungen zur Frage, was Philosophie nach dem Rückfall in die Barbarei während des Zweiten Weltkriegs noch bedeuten kann, Fleisch und Saft. Sie lassen das Denken der Protagonisten nicht im luftleeren Raum schweben, sondern leiten es – zumindest teilweise – aus ihren Biografien bzw. ihrer Selbstbefragung ab.
Gemeinsam ist Adorno, Feyerabend, Foucault und Sontag, dass sie sich gegen normative, generalisierende Theorien wandten und selbst keine Schulen begründeten, dafür aber einen Zug zum Literarischen bzw. Musischen und zur Lebenskunst zeigten. „Geister der Gegenwart“ nennt Eilenberger die zwischen 1969 und 2004 Verstorbenen, weil sie immer noch „als Gespenster durch unsere Diskursräume wabern“, wie er dem Philosophie Magazin erklärte.
„Wir leben in einer Zeit, die bewusst auf Gesundheit aus ist und dennoch allein an die Realität der Krankheit glaubt“, formulierte etwa Sontag 1978 im Essay „Krankheit als Metapher“, den sie nach ihrer Krebsdiagnose verfasst hatte. Ein Satz, der nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Als roter Faden zieht sich Kants legendäre Definition vom „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ durch Eilenbergers Buch. Er begreift die Philosophierebellen nicht als Vertreter oder Vorbereiter der Postmoderne, sondern als Aufklärer. „Sie wollten den Kern der Moderne retten, nicht überwinden“, sagt er im erwähnten Interview.
Auch hegten alle vier eine gewisse Skepsis gegen gewaltsame Revolutionen, mit denen sie in den Jahren 1967 bis 1969 hautnah in Kontakt kamen. Eilenberger lässt das Gefahrenpotenzial aktivistischer Instrumentalisierung für das Denken spürbar werden, wenn er die Besetzung der neuen Universität in Vincennes im Januar 1969 schildert, bei der sich Michel Foucault trotzdem zu Handgreiflichkeiten hinreißen ließ, oder Adornos Auseinandersetzung mit den revoltierenden Studenten in Frankfurt.
Spannend wird es, wenn er Verbindungen zwischen den Werken darstellt, etwa dass Paul Feyerabends „Against Method“ (dt. „Wider den Methodenzwang“, 1975) nicht nur im Titel auf Susan Sontags „Against Interpretation“ (1964) anspielt – auch wenn sich der Wiener Freigeist Feyerabend auf die Wissenschaftstheorie bezieht und die angriffslustige New Yorker Szene-Ikone auf Kunst.
Sontags Essay „Notes on ,Camp‘“ hingegen liest er als Antwort auf Adornos „Minima Moralia“: „Bätsch, es gibt sehr wohl ein richtiges Leben im falschen. Man muss es dafür eben nur so richtig falsch machen wollen!“ Und kann damit in einer Zeit der Massenkultur sogar noch Dandy sein.
Letztlich erweisen sich alle vier als egomanische Snobs, daher kann man Eilenbergers Abschluss der „Trilogie“ auch als eine Entzauberung lesen. Am Anfang seien ihm alle außer Feyerabend unsympathisch gewesen, gesteht er im Interview. Nach der Lektüre dieses Buchs muss man sie nicht mögen, aber man kann ihren unbestechlichen Denkanstrengungen Respekt zollen