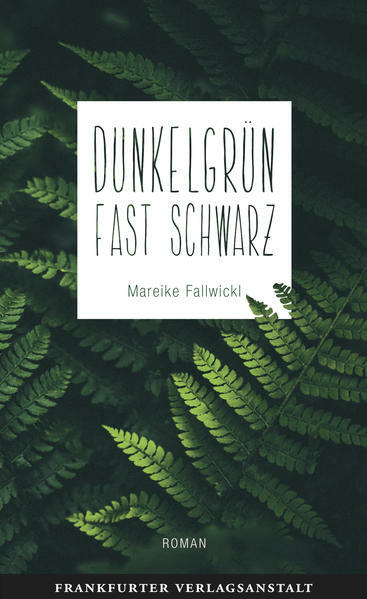Fifty Shades of Dunkelgrün
Klaus Nüchtern in FALTER 10/2018 vom 07.03.2018 (S. 35)
Mareike Fallwickl bedient mit ihrem Debüt das Genre des juvenilen Dreiecksdramas und scheitert mit hohem Aufwand
Sex. Verrat. Gewalt. Dunkle Dreiecksdramen unter Heranwachsenden in der Provinz. Nach „Faber. Der Zerstörer“, dem dritten Roman des gehypten Philosophen Tristan Garcia, und dem Bestseller der jungen Belgierin Lize Spit, „Und es schmilzt“, hat sich nun auch die Salzburgerin Mareike Fallwickl (Jg. 1983) an der Weiterentwicklung des offenbar gerade angesagten Sujets beteiligt.
„Dunkelgrün fast schwarz“ ist, wie der Klappentext verrät, das „literarische Debüt“ der Texterin, Bloggerin und Kolumnistin. Es ist der Spitzentitel der Frankfurter Verlagsanstalt in diesem Frühjahr, die Fallwickls vorangegangenen Roman „Auf Touren“ – 2012 in der Erotik-Reihe „Anais“ des Schwarzkopf Verlags erschienen – offenbar nicht als satisfaktionsfähigen Vorläufer anerkennt. Mutmaßlich zu Recht.
Wie auch die genannten Romane von Spiz und Garcia setzt die gebürtige Halleinerin auf die Konstellation „Zwei Männer und eine Frau“, wobei sie über die Ménage-à-trois der Pro-
tagonisten hinausgeht, indem sie auch Marie, die Mutter von Moritz, zu Wort kommen lässt.
Moritz, das ist der etwas verhuschte und ichschwache Teil des Trios, das durch den flamboyanten, aber fiesen Raffael und die Frau zwischen beiden, Johanna, ergänzt wird. Dass sich Dunkles unter den Dreien zugetragen haben muss, man ahnt es, aber es dauert ein paar hundert Seiten, bevor der verschwiegene und verdrängte Kern des Konflikts endlich zur Sprache gelangt.
2017 sind die drei Kindheits- respektive Schulspezln längst in ihren 30ern angelangt und haben sich ewig nicht gesehen, als Raffael eines Tages aus dem Blitzblauen im Halleiner Haus von Moritz und dessen hochschwangerer Gattin Kristin auftaucht. Mit der Unverfrorenheit, zu der ihn alte Bande offenbar berechtigen, nistet er sich dort ein, bis Kristin, die von dem ebenso charismatischen wie selbstgefälligen Jugendfreund noch nie etwas gehört hat, ihren Mann bittet, den ungebetenen Gast schleunigst wieder vor die Tür zu setzen.
Seit „Motz“ von „Raf“ am Kinderspielplatz zum Freund auserkoren worden ist, vermag er sich der fatal attraction nicht zu entziehen, daran hat auch die jahrelange Beziehungspause nichts geändert. An sich gäbe das eine gute Grundlage für einen Psychothriller. Im Kino der 80er- und 90er-Jahre hätte Rob Lowe den Raffael gegeben. Und tatsächlich hat Fallwickl ihren Roman auch mit einem Krimiplot ausgestattet, der freilich ziemlich läppisch geraten ist und dann auch sang- und klanglos versandet, so, als hätte die Autorin ihr ohnedies geringes Interesse daran endgültig verloren.
Die zwischen 1982 und 2017 vor und zurück sowie den unterschiedlichen Perspektiven hin und her zappende Erzählweise mag als Indiz für formale Ambitioniertheit genommen werden, erweist sich aber als Ballast, der den ohnedies nicht eben reißenden Handlungsfluss noch zusätzlich bremst.
Fallwickl kompensiert dieses Manko, indem sie ihren Roman rhetorisch gnadenlos hochtunt. Wer das Auto nicht in der Kurve halten kann, sollte aber nicht unbedingt auch noch den Motor auffrisieren.
Dutzende von übersteuerten Wie-Vergleichen („Ihr Kuss auf meiner Wange fühlte sich an wie eine Verbrennung“; „Ich spüre ihre nasse Wange an meiner, und ihre Körperlichkeit ist wie eine Ohrfeige“; „Nach der Hitze im Club fühlt sich die Nachtluft an wie ein Ohrfeige“; „Die Überraschung brennt auf meiner Haut wie Mandarinensäure in einer Schnittwunde“), pathetischer Unfug („Freundschaft macht, dass die Schreie, die du auf der Innenseite deiner Haut tätowiert hast, hörbar werden“) und pseudoabgebrühte Sentenzen („das Internet ist in Sachen Ficken eine Schlangengrube voller Untiefen“) sind schon arg daneben. Noch schlimmer aber wird es, wenn die Erzählerin „auf Touren“ kommt: „,Wie nass du bist, kleine Sub’, murmelte er, ,komm und hol ihn dir.‘ (…) Als er endlich zustieß, kamen ihr Tränen vor Erleichterung. Ihr Kopf schlug gegen das lackierte, dunkle Holz, der Kabelbinder schnürte ihr das Blut ab (…). Und es war gut so. Sie tauchte in die Erniedrigung wie in ein heilsames Vollmondbad.“
Das dergleichen sein Publikum hat, wird man zur Kenntnis nehmen müssen. Schade bloß, dass die Autorin eine Chance leichtfertig verspielt hat. In dem aufgeschwollenen und vollkommen überinstrumentierten Roman – Moritz ist zu allem Überfluss auch noch ein Hypersynästhet, der nicht nur ständig von farbigen Auren behelligt wird (daher der Titel), sondern auch von Geruchs- und Geschmacksempfindungen – schlummert nämlich ein schlankes Buch, das man gerne gerettet hätte. Es handelt von einer jungen Frau, die gleich beim ersten Mal geschwängert wird und sich in Hallein als Hausfrau und Mutter einzurichten trachtet.
Moritz’ Mutter Marie ist mit Abstand die überzeugendste Figur, weil ihr eher durchschnittliches Elend zwischen Vollwertküche und Verzweiflungssex mit dem Mann der Nachbarin nachvollziehbar ist. Wie sie versucht, ihren Sohn vor dem besten Freund zu bewahren oder später dessen schwangere Freundin bemuttert, ist tatsächlich anrührend. Als Einzige darf sie sich in der ersten Person artikulieren, was sie vor dem Stilblütenhagel bewahrt, der über alle anderen Figuren herniedergeht, auch wenn ihr Sätze wie der folgende in den Mund gelegt werden: „Kinder sind ein ebenso guter Grund für eine Beziehung wie jeder andere auch, manchmal sind sie ein besserer Kleber als Zuneigung, die mit den Jahren stumpf wird und schwach.“
Dass solches einer Frau Anfang 40 im Jahr 2001 durch den Kopf geht – man weiß nicht, ob man es für sehr unglaubwürdig oder sehr traurig halten soll. Damit, einen zeitgemäßen Ton zu finden, hat die Autorin aber generell ihre liebe Not. „Die Erwachsenen sind komisch“, denkt sich der kleine Motz einmal. „Die sagen auch ,Ja, passt schon, alles gut‘“. Nein, das hat im Jahr 1986 eben niemand gesagt. An „Dunkelgrün fast schwarz“ passt fast gar nichts. Und das ist nicht gut so.