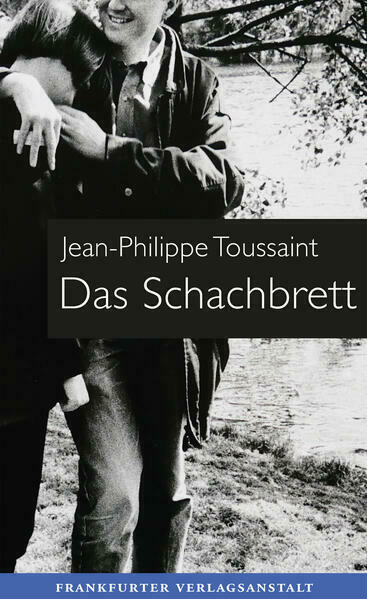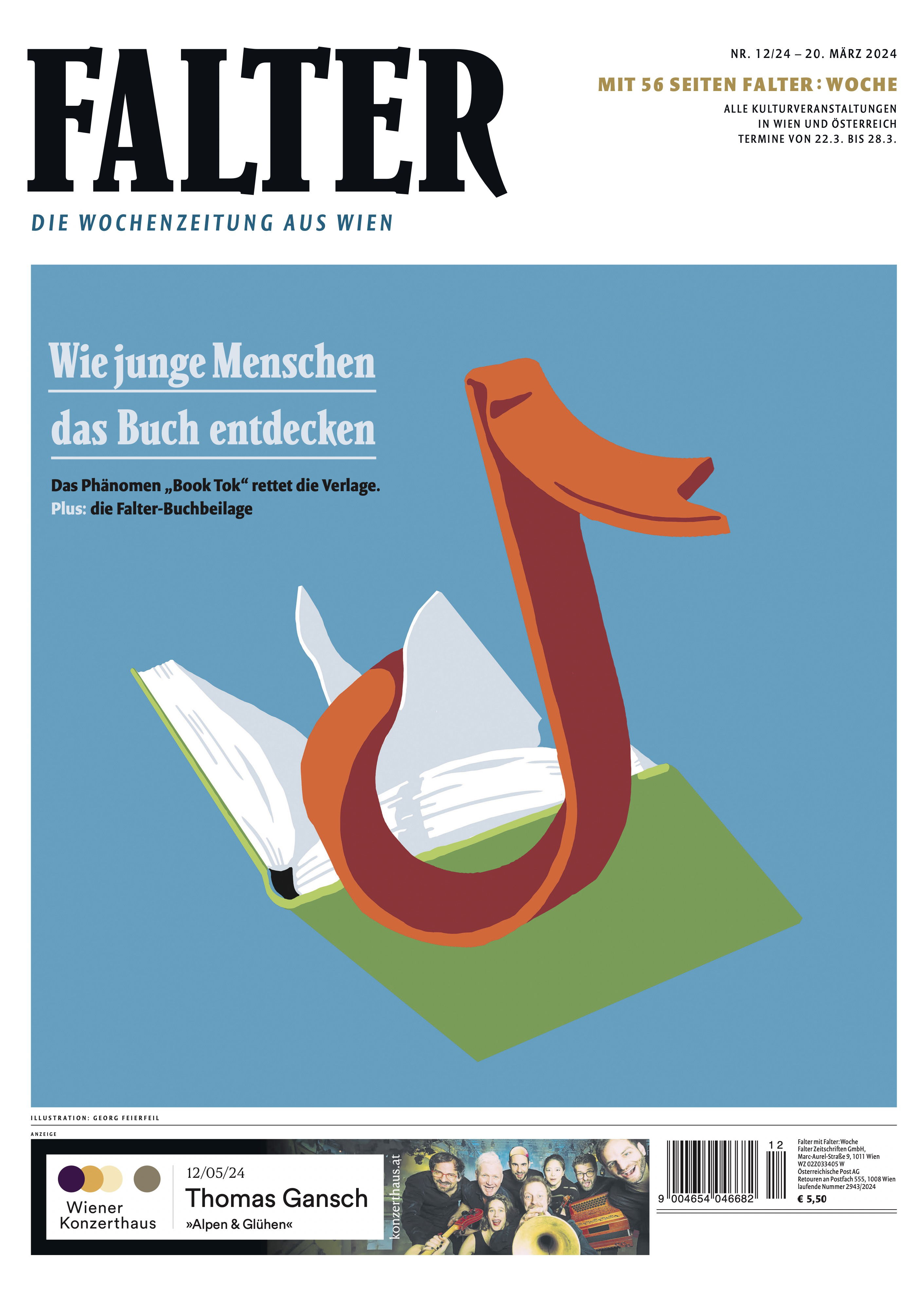
Die Wehwehchen eines Hypochonders
Thomas Leitner in FALTER 12/2024 vom 20.03.2024 (S. 19)
Der monumentale Eingangssatz lautet: „Ich habe das Alter erwartet, ich finde mich im Lockdown wieder.“ Der Beginn von Jean-Philippe Toussaints neuem Buch „Das Schachbrett“ klingt im französischen Original wuchtiger, nimmt er dort doch die Gestalt eines Alexandriners an, der jambischen Versform in der klassischen Tragödie etwa eines Racine. Der Satz bildet den ersten von 64 Abschnitten, die das Werk einem Schachbrett gleich gliedern.
Wer nun vermutet, einen weiteren dieser Covid-Romane vor sich zu haben, irrt. Wohl behandelt Toussaint die Pandemie. Die Situation der Ein- bzw. Abgeschlossenheit ist für ihn aber schon Gegenstand seiner Reflexionen, seit er 1985 den Debütroman „Das Badezimmer“ veröffentlichte.
Das Altern und Probleme mit einer Übersetzungsarbeit beschäftigen ihn mindestens ebenso intensiv. Es geht um Stefan Zweigs „Schachnovelle“. Als Amateurspieler und Zuschauer bei Großereignissen behandelt sie ein ihm vertrautes Terrain. So wird die lebenslange, in unterschiedlicher Intensität gepflegte Beziehung zu diesem Denksport zum Leitfaden der Erinnerung.
Vorbilder sind ihm neben Marcel Proust auch Nabokov und Georges Perec, beide Schachliebhaber. Von Letzteren übernimmt Toussaint als gestalterisches Prinzip des Buches die Problemstellung der „Polygraphie des Springers“. Es geht darum, wie man diese Figur so bewegt, dass sie alle Felder des Schachbretts einmal besetzt, ohne zweimal auf demselben zu landen.
Bestechend elegant beschreibt er sein literarisches Vorhaben: „Ich wollte, dass dieses Buch ein weitgreifendes Nachdenken über die Literatur wird und dass es gleichzeitig über das Entstehen dieses Buches erzählt, seine eigene Genese beschreibt, sein Reifen und Voranschreiten, und dass es das in Echtzeit erzählt.“
Toussaint erörtert die Bedingungen für das Erinnern, Schreiben und Übersetzen auf eine Weise, die man im klassischen Sinn transzendental nennen könnte. So anspruchsvoll sein Programm erscheint, so leichtfüßig zieht er es durch.
Er geht zurück bis in die früheste Kindheit und reflektiert auch Erinnerungen aus zweiter Hand: Man hat ihm erzählt, dass er – im Allgemeinen ein fröhlicher Säugling – für zwei Tage in eine seltsame Apathie verfallen sei.
Nun überlegt er, ob er damals schon mit dem Phänomen des Gedächtnisses konfrontiert wurde und der Melancholie begegnete. Freilich blitzt hier Selbstironie durch. Diese nonchalante Haltung dem eigenen Ich gegenüber trägt zum Lesevergnügen bei.
Einen fast schelmischen Blick wirft Toussaint auf die großbürgerliche Atmosphäre des Elternhauses in Brüssel. Differenziert und einfühlsam wird der Autoritätskonflikt mit dem Vater, einem Starjournalisten, ausgetragen („Im Schach schlage mich nicht, aber ja, werde ein größerer Autor“, legt der Sohn ihm in den Mund).
Mit der Figur des litauischen Großvaters, ehemaliger zaristischer Offizier, evoziert er den letzten Nachhall der russischen Emigrantenszene in Paris. Auch an den Wehwehchen eines Hypochonders in den Sechzigern und seinen Marotten lässt er den Leser teilhaben, etwa wenn er sich rühmt, seinem Augenarzt gegenüber Knieschmerzen, die ihn auch plagen, nicht zu erwähnen. Wenn es zu persönlich werden könnte, bricht er jedoch ab.
Gewinnend ehrlich schildert er den Ehrgeiz, sich beim Übersetzen eines Werkes im Text persönlich bemerkbar zu machen. Das wird Joachim Unseld, der Toussaints Bücher verlegt und diese seit 20 Jahren kongenial übersetzt, amüsiert haben. Immerhin wurde auch ihm bei der Übertragung von „Das Badezimmer“ ein gewisser Hang zur Originalität attestiert.
Trotz aller Ironie und all seinem Sarkasmus herrscht hier ein fast Tschechow’sches Gleichgewicht zwischen Humor, melancholischem Ernst und tieferer Bedeutung. Dieser dichte Text zieht in seinen Bann.