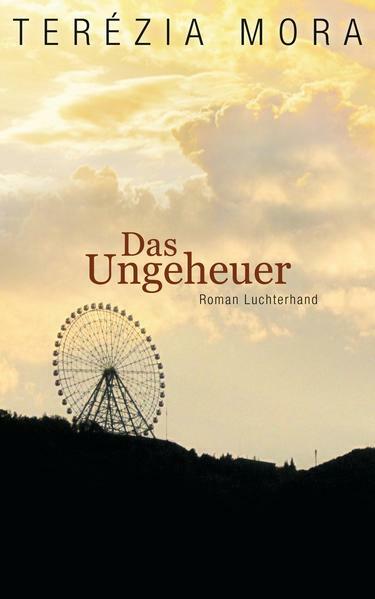"Ich habe großes Vertrauen zu Dicken"
Klaus Nüchtern in FALTER 51-52/2013 vom 18.12.2013 (S. 34)
Das Schriftstellerleben fühlt sich für Terézia Mora nicht sexy an. Weibliche Erfolgsangst? Problematisch. Das Beleidigtsein der Osteuropäer? Doof
Mit ihrem Roman "Das Ungeheuer" vermochte Terézia Mora nicht nur die Jury des Deutschen Buchpreises zu überzeugen (siehe auch Falter-Jahrescharts auf Seite 32f.). Die meisten Kritiker (mit Ausnahme von Medienclown Denis Scheck, der das ARD-Magazin "Druckfrisch" moderiert) zeigten sich beeindruckt vom zweiten Teil der Trilogie, die Mora mit "Der einzige Mann auf dem Kontinent" 2009 begonnen hat. Seinerzeit verlor der übergewichtige und arglose IT-Heini Darius Kopp lediglich seinen Job. Diesmal verliert er seine geliebte Frau Flora, die sich erhängt hat. Von ihrer Depression hat Kopp so wenig Ahnung wie von vielen anderen Facetten ihres Lebens, denen er in diesem Roman nachspürt und buchstäblich nachfährt. "Das Ungeheuer" ist horizontal zweigeteilt: Oben liest man Kopps Geschichte, unten die Notate, die Flora auf ihrem Laptop hinterlassen hat. Der Falter traf Mora in München, wo sie am 11.12.13 eine Lesung im Literaturhaus hatte.
Falter: Ihr erstes Buch, "Seltsame Materie", erschien vor 14 Jahren, und die offizielle Biografie Ihres Verlages listet 14 Preise und Stipendien auf.
Terézia Mora: So viele?! Mir kommt es weniger vor. Bevor ich den Deutschen Buchpreis bekommen habe, hatte ich wieder mal so eine Anwandlung: "X hat schon wieder einen Preis bekommen, und ich?!"
Aber über mangelnde Aufmerksamkeit müssen Sie sich nicht beklagen, oder?
Mora: Nein, aber heutzutage ist es einfach nicht mehr so besonders, dass eine schreibende Frau öffentlich präsent ist. Aus Autorinnen werden weniger Ikonen geschnitzt als früher. Außerdem ist es für einen Mann attraktiv, Schriftsteller zu sein, aber wenn du als Frau sagst: "Ich bin Schriftstellerin", macht dich das nicht sexy.
Aha?!
Mora: Nö. Autoren hingegen erzählen mir, dass tatsächlich
die Höschen auf die Bühne fliegen?
Mora: Mehr oder weniger.
Das hat wohl rein statistische Gründe: Das Publikum für schöne Literatur ist nun einmal zu 80 Prozent weiblich.
Mora: Bei mir waren neulich in Stuttgart auffällig viele Männer. Davor habe ich so was nur einmal in Hannover erlebt, wo 30 Kerle dasaßen. Das lag aber daran, dass es der Betriebsausflug von Siemens war: Die haben ihre Ingenieure in die Lesung vom "Einzigen Mann" gelotst. Sie haben sich schiefgelacht, weil sie viele Sachen wiedererkannten, die bei einem durchschnittlichen weiblichen Publikum keine Resonanz finden. Ich dachte gleich: Warum kann Siemens nicht immer zu meinen Lesungen kommen?!
Sie haben erzählt, dass Sie viele Ihrer Recherchen zum ersten Kopp-Roman dann doch nicht verwenden konnten.
Mora: Ich hatte mir wirklich ganz genau aufgeschrieben, wie da geredet wird, habe mich aber dann gegen den Naturalismus entschieden. Es wäre sonst zu speziell und hermetisch geworden. Jemand wie Kathrin Röggla ist immer ein sehr hohes Risiko eingegangen, weil sie sich sehr stark am Tagesgeschehen orientiert hat. Ich verstehe und respektiere das total, würde es mich selber aber nicht trauen, weil ich Angst hätte, dass es sich übermorgen als irrelevant herausstellt.
Wie und wo haben Sie denn recherchiert?
Mora: Hauptsächlich durch direkte Beobachtung meines Büronachbarn, sprich: meines Mannes. Als ich aus der "Seltsamen Materie" herauskam und mich umsah, fand ich zwei Anschauungsobjekte: Objekt Nummer eins – die sehr heterogene Gruppe von Emigranten, die aus Südosteuropa nach Berlin gekommen waren; Objekt Nummer zwei – die IT-Branche der 90er-Jahre. Es ist schon erstaunlich, wie unreflektiert die sind – und zwar absichtlich. Als ich einen Kollegen meines Mannes fragte, wie er sich sein Arbeitsleben in 20 Jahren vorstellt, bekam ich wortwörtlich die Antwort: "So lange ich arbeiten muss, wird sich das System noch halten, und was danach kommt, interessiert mich nicht." Nach mir die Sintflut!
Aber Darius Kopp ist doch ein Sympathieträger?!
Mora: Ja, weil ich natürlich keine Lust hätte, mit einem Arschloch 1000 Seiten zu bestreiten; und weil ich ein paar von denen auch mag: Die werden dann zu Kopp, und die ich nicht ausstehen kann, werden zu Juri.
Mögen Sie eigentlich Dicke?
Mora: Ja! Ich habe großes Vertrauen zu Dicken – obwohl ich auch einige sehr vertrauenswürdige Pfeifenreiniger kenne.
Die Kopp-Romane sind ja stark über die Körperlichkeit des Protagonisten erzählt?
Mora: Ach ja? Erklären Sie doch mal.
Er schwitzt, keucht, irrt an Unorten herum und hat Stress. Und dann spendieren Sie ihm eine Fußmassage in der Shopping-Mall. Das fand ich sehr nett!
Mora: Nicht?! Und ausgerechnet die Szene wollte mein Lektor rausschmeißen, weil er sie nur als retardierendes Moment wahrgenommen hat. Apropos "Körper": Mit meinem Körper stellt das Reisen ja schlimme Dinge an, über die ich aber nicht schreiben wollte, weil das too much gewesen wäre. Also habe ich Kopp einen robusten Körper gegeben, der überall schlafen und auch Mist essen kann, ohne dass es ihn umbringt. Ich war übrigens total schockiert, als meine Ärztin mir erklärte, dass man ein halbes Jahr lang nur Cola trinken und Salzstangen essen kann, ohne dass ein Mangel auftritt.
Wie ist die Figur von Kopps Frau Flora entstanden?
Mora: Zunächst einmal ganz unspektakulär. Die Urszene des "Einzigen Mannes" ist die Passage, in der Kopp sich in sein Hemd zwängt und dabei fast abkragelt. Da ist Flora einfach das Kontrastprogramm: Sie ist ruhig, unterstützend, hat Humor, kriegt den Knopf auf. Zugleich habe ich alles, was ich übers Scheitern weiß, ihr draufgepackt.
Wenn Sie es in Deutschland nicht geschafft hätten, wären Sie vielleicht auch eine Flora geworden?
Mora: Mir fallen auf Anhieb drei junge, kluge, talentierte Frauen ein, mit denen ich studiert habe, und die es nicht gepackt haben. Wenn du einmal anfängst, es nicht zu packen, wirst du immer schwächer: Du strampelst die ganze Zeit, aber es geht trotzdem abwärts. Und das betrifft traurigerweise Frauen stärker als Männer. Die wollen es selber schaffen, und es ist ihnen scheißegal, ob du es schaffst. Wenn du willst, dass sie dir zuhören, musst du ihnen auf die Nerven gehen – wofür sich viele Frauen zu schade sind. Ist aber ein Fehler!
Ist Flora zu gut für die Welt?
Mora: Nein, sie ist nicht nur ein Opfer äußerer Umstände. Sie könnte ja zum Beispiel auch Probeübersetzungen an Verlage schicken. Was hindert sie daran? Ich begegne immer wieder Frauen, die mir erklären, dass sie sich an ihre kleinen Jobs klammern, weil sie eigentlich Zeit zum Schreiben haben wollen. Wenn ich frage, ob sie was fertig haben: nein, natürlich nicht. Am Ende gelingt es auch noch, und man müsste sich mit einer anderen Struktur auseinandersetzen als mit der, in der man bisher gelebt hat. Das hört sich überheblich an, aber es ist genau so: Du musst das Scheißding fertig machen und du musst es irgendjemandem geben, der nicht dein Freund ist.
Gab's denn Momente, in denen Ihre Karriere auf einmal steil nach oben ging?
Mora: Nein. Am Jahresende verspüre ich bis heute immer noch diese Erleichterung: Aha, ich hab's aus eigener Kraft geschafft.
Es geht aber nicht bloß ums Überleben?!
Mora: Nein. Und wenn ich mir anschaue, wie ich am ersten, zweiten, dritten und vierten Buch gearbeitet habe, sehe ich ja auch, dass ich mein Handwerk weiterentwickelt und anständig gearbeitet habe. Was macht den Menschen glücklich? Na, zum Beispiel, Kompetenz zu entwickeln. Aber natürlich denkt man sich dann auch: Ich habe alles aus mir rausgeholt, was ging. Kommt jetzt noch was? Die Gefahr, dass man sich ausgeschrieben hat, besteht nun mal.
Treffen Sie Vorkehrungen, um das zu verhindern?
Mora: Was soll ich da denn machen?!
Zum Beispiel Wiederholungen vermeiden.
Mora: Das schon. Deswegen schreibe ich auch nicht gleich den dritten Teil der Trilogie, sondern mache als Frischzellenkur erst mal Erzählungen. Schon Jandl wusste: "Wenn etwas gut läuft, hör auf damit!"
Die Struktur der Kopp-Romane war von Anfang an klar?
Mora: Bei den ersten beiden schon, beim dritten nicht. Das Problem ist, dass sich der zweite Teil nicht noch steigern lässt. Was soll draus werden, ein Rokokoschloss?!
These, Antithese, Synthese?
Mora: Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich habe in anderen Dreiheiten gedacht: Glaube, Liebe, Hoffnung – solche Sachen. Was kann man Hiob noch wegnehmen, nachdem ihm schon seine Herde und seine Familie genommen wurden? Welchen Verlust kann man am Ende in einen Gewinn umwandeln? Ich muss mir einfach noch genauer ansehen, wie das andere Schriftsteller in ihren Trilogien gelöst haben.
Ach so geht das!
Mora: Jaaa, Literatur entsteht aus anderer Literatur.
Einflussängste plagen Sie nicht?
Mora: Nö. Die Strategie ist einfach: Flucht nach vorne. Sollte sich also Updike mit seinen "Rabbit"-Romanen als starker Einfluss entpuppen, werde ich das in meinem Buch auch thematisieren.
Sie sind bei Sopron aufgewachsen. Dort fuhren die Österreicher immer hin, um billig zu essen. Wie war Ihre Erfahrung mit uns?
Mora: Ich war ja nicht in Sopron, sondern auf dem Dorf. Allerdings kamen unsere österreichischen Verwandten tatsächlich immer zum Essen. Wenn's ums Essen geht, scheint auf die Österreicher also Verlass zu sein. Ich bin aber immun gegen dieses osteuropäische Beleidigtsein. Die Österreicher deswegen zu hassen, weil sie sich das Essen in Ungarn leisten können, ist dämlich. Das demütigt mich doch nicht! Wir haben allerdings nicht das Recht, für 300 Euro all-inclusive unsere Plauze am Buffet entlangzuschieben und die Natur anderer Länder zu ruinieren.
Wo machen Sie dann Urlaub?
Mora: In Ungarn! Denn dort – Sie hören eine Sendung des ungarischen Tourismusverbands – finden Sie alles, was das Herz begehrt.
Mit dem Bergsteigen wird's schwierig.
Mora: Da muss man dann kurz nach Österreich hüpfen. In Österreich und Ungarn findet man eigentlich alles – bloß kein Meer. Also lassen wir halt die Kroaten auch noch mitmachen. Dann haben wir aber echt alles!
Ich habe gelesen, dass Sie "Kruisbergerisch" gesprochen haben.
Mora: Ich nicht mehr, aber meine Oma konnte es noch. Das leitet sich von Kroisbach ab, dem deutschen Namen für Fertörákos. Meine Oma kann angeblich hören, ob jemand aus Mörbisch, aus Rust, Kroisbach, Oggau oder Oslip stammt. Wir haben halt so Ausdrücke, die ich gerne an Österreichern teste: "Ois muass i z'sammschetzkern" kennt aber niemand.
Was soll das heißen?
Mora: "Ich muss alles selber machen!"
Sie waren und sind aber Ungarin?
Mora: Ja. Ich habe zwar zuerst Deutsch gesprochen, aber die dominante Sprache der Umgebung war Ungarisch, und der ungarische Kommunismus hat mich stark geprägt. Das ist also schon meine Heimat, auch wenn es nicht immer angenehm ist.
Als jemand, der Deutsch sprach, sind Sie aber auch angefeindet worden??
Mora: Schon, aber man muss auch klar sehen, wie das läuft. Wenn in einer Gemeinschaft einer des anderen Wolf ist, dann findet man immer einen Grund: ob man nun Deutscher, Jude oder Zigeuner ist. Und wenn gar nichts übrig bleibt, stehen halt die Ohren ab. Irgendwas wird sich finden!
Das ist wie im Witz mit dem Hasen und
Mora:
der Mütze?!
Genau.
Mora: Die Ungarn lieben diesen Witz! Weil sie wissen, dass das ihr Leben ist: Hast du eine Mütze auf, kriegst du deswegen eine reingehauen; hast du keine auf, dann wirst du deswegen vermöbelt. Man kann sich also fragen: Warum sind wir Ungarn so? Sind alle Gemeinschaften so? Oder haben sich manche bloß besser im Griff?
Momentan haben sich die Ungarn nicht so gut im Griff.
Mora: Nein, haben sie nicht. Viele junge Ungarn haben das Land verlassen, aber nicht, weil es ihnen anderswo materiell besser geht, sondern weil sie dort anerkannt werden. In Ungarn kannst du hart arbeiten, absolut anständig bleiben und trotzdem kriegst du ein Dutzend Mal am Tag eine in die Fresse. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich – erst vor kurzem! – dahintergekommen bin, dass das nichts mit dem Kommunismus zu tun hatte, sondern immer noch so ist.
Sie leben in Berlin am Prenzlauer Berg. Da sind die Klischees natürlich etwas freundlicher.
Mora: Nämlich?
Lauter Caffè Latte trinkende Kinderwagenschieber, sehr komfortabel.
Mora: Das stimmt schon: Gewisse soziale Härten gibt es nicht, der Stadtteil ist sehr homogen, es gibt einen Akademikeranteil von 60 Prozent. Aber was willst du machen? Das Kind in die Rütli-Schule schicken, damit es nicht verweichlicht wird und das wahre Leben kennenlernt? Was soll denn der Mist?! Ich freue mich, dass mein Kind so aufwachsen kann.
Odysseus ernährt sich von Pizza
Kirstin Breitenfellner in FALTER 41/2013 vom 09.10.2013 (S. 25)
Terézia Mora legt mit "Das Ungeheuer" Teil zwei ihrer Trilogie über den IT-Fachmann Darius Kopp vor
Du bist die Liebe meines Lebens. Und, ach ja, ich bin gefeuert worden", sagt Darius Kopp zu seiner Frau Flora. Den klassischen Literaturthemen Liebe und Tod fügte Terézia Mora mit ihrem letzten Roman "Der einzige Mann auf dem Kontinent" (2009), in dem Kopp seinen ersten Auftritt bekam, ein weiteres hinzu: die Arbeit. In "Das Ungeheuer", Band zwei der projektierten Trilogie über den übergewichtigen ostdeutschen IT-Fachmann in der Welt von Wirtschafts- bzw. Finanzkrise und McJob, führt sie diese drei Themen eng.
Denn Kopps Frau Flora hat sich, nach neun Jahren Ehe und vier Tage vor ihrem 38. Geburtstag, das Leben genommen und damit ihre Gefühle der Ohnmacht und des Schmerzes auf ihren Mann übertragen. Kopp kann nicht mehr arbeiten und frisst sich monatelang durch die Pizzakarte des Hauszustellers, bevor er, um seine Frau zu begraben und womöglich besser zu verstehen, zu einer Reise aufbricht, die ihn von Berlin über Floras Heimat Ungarn quer durch Südosteuropa bis nach Georgien und Armenien und schließlich Athen führt.
Mit im Gepäck: die Urne seiner Frau sowie deren Tagebuchaufzeichnungen, die Kopp übersetzen ließ und die Mora uns ebenfalls zur Gänze zu lesen gibt – auf dem unteren Drittel der Buchseiten, die unter einem schwarzen Querbalken allerdings lange frei bleiben.
Eigentlich müsste man diesem Buch, dessen zwei Lesebändchen zunächst Rätsel aufgeben, eine Leseanleitung voranschicken, aber das wäre vermutlich uncool. Die Flora-Kapitel, die konventionell durchnummeriert sind, hätte man getrost auch hintereinander drucken können, allerdings wäre damit Floras Parallelleben, deren düstere Untergrundexistenz nicht auf diese Weise sichtbar und fühlbar geworden.
Aus Floras Erinnerungen, Reflexionen und Lektürefrüchten – inklusive seitenweise Zitaten aus psychologischen Handbüchern – ergibt sich das Psychogramm einer klinischen Depression, gegen deren Diagnose sich Flora zwar verwehrt, die aber durch ihre Kindheit sowie traumatisierende Erlebnisse als Erwachsene hinreichend motiviert wird. Das gemeinsame Leben, die Ehe, erschließt sich ausschließlich aus den Darius-Kapiteln und die Flashbacks, die den sich auf der Suche oder vielmehr Flucht befindlichen Witwer immer wieder überfallen. In Floras Aufzeichnungen hingegen kommt er so gut wie gar nicht vor – und genau darin besteht das Beklemmende dieser Geschichte einer unerfüllten Liebe.
Moras bekannt schmuckloser Duktus hält sich nicht mit ausführlichen Beschreibungen oder elaborierten Adjektiven auf. Und trotz der durchaus exotischen Schauplätze befindet sich die Hauptbühne im Kopf des Helden. Dass dennoch ein dem Genre der Road Novel angemessener Drive entsteht, verdankt sich nicht nur dem ständigen Perspektivwechsel zwischen erster und dritter Person, sondern auch Kopps innerer wie äußerer Getriebenheit, die nicht von ungefähr an Döblins Franz Biberkopf und Joyces Leopold Bloom erinnert.
"Immerhin bin ich kein Nazi. Nein, nur ein gewöhnlicher Feigling." Und: "Ich bin etwas einfach gestrickt. Essen, Sex, und schon bin ich befriedet", sagt Kopp über sich selbst. Als Mann ohne Eigenschaften angelegt, gibt er trotzdem einen glaubwürdigen Schmerzensmann ab, der durch die Unbedingtheit seiner Trauer und die Anteilnahme am Unglück seiner Frau zunehmend an Tiefe gewinnt.
Die Depression gehört zu jenen Krankheiten, die die Empathiefähigkeit zerstört, den Menschen auf sein Leiden zurückwirft. "Warum hast du dich vor mir versteckt?", fragt Darius nach der Lektüre der Aufzeichnungen. So, wie Flora einsam war mit Darius und trotz seiner Anwesenheit, ist dieser nun einsam ohne Flora und in dem vollen Bewusstsein ihrer Gleichgültigkeit, um nicht zu sagen Rücksichtslosigkeit.
"Wenn du dich schon zerstören musst, dann tue es diskret oder so schnell, dass andere keine Schaden daran nehmen. Den Schmerz, der dir nachfolgt, kannst du aber auch dann keinem nehmen. Verzeih, dass ich dich da hineingezogen habe", schreibt Flora einmal. Ansonsten gibt es in ihrer fatalen Selbstbezogenheit, die zwischen Selbstverachtung und Arroganz, Selbstverleugnung und harschem Stolz hin und her wechselt, keine sichtbare Lücke.
Zu ihrer vermutlich lesbischen Freundin Gaby sagt sie einmal, dass Darius sie schöner sehe, als sie wirklich sei – und dass
seine Immunität sie tröste. "Dass er mit jemandem wie mir zusammenleben kann, ohne dass er davon angegriffen wird. Er bleibt stets, was er von Anfang an war." Damit wird sie am Ende nicht Recht behalten.
Dass Kopp, dieser Widergänger des Odysseus, in diesem Sumpf, dieser Unterwelt nicht ganz zugrunde geht, hat er nicht zuletzt den zahlreichen Menschen zu verdanken, die er unterwegs trifft, die ihn begleiten, einladen, spiegeln und herausfordern. "Wir sind alle überflüssig", weiß er zum Schluss. "Langsam, ganz langsam nur, begreife ich. Dass der gelungene Mensch die Ausnahme ist, nicht die Regel, deswegen spricht man ja auch von einem Ideal. Ich liebe dich so, wie du bist."
In eine Athener Demonstration geraten, kann er schließlich – wenn auch nur aufgrund des von der Polizei eingesetzten Tränengases – sogar weinen und dann auch lachen. "Man kann es sich nicht vorstellen, aber mit der Zeit nimmt die Trauer ab und auch alle anderen Gefühle. Ein Lebendiger kann nicht mit einem Toten leben, so ist das einfach."
Noch erschöpft von dieser fast 700 Seiten langen Totalabreibung fragt man sich bange, was Mora im dritten Teil mit diesem Ritter von trauriger Gestalt wohl noch vorhaben kann.