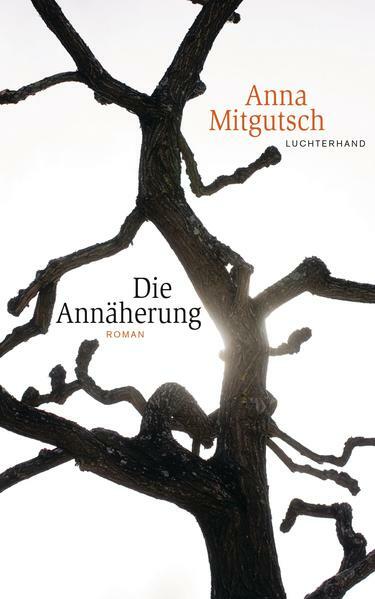Die Väter waren nicht nur Täter
Julia Kospach in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 8)
In „Die Annäherung“ gewinnt Anna Mitgutsch dem Konflikt zwischen der Kriegsgeneration und deren Kindern neu Facetten ab
Es ist eine vertrackte Beziehungskonstellation, wie es viele gibt und noch viele mehr gegeben haben muss, zwischen den Vätern der Kriegsgeneration und ihren Kindern, die in den 1960er-Jahren auf die Uni gingen. „Er hätte es ihr erzählt, wäre sie nicht so unbarmherzig darauf aus gewesen, ihn zu verurteilen.“ So denkt Theo, der Vater, wenn seine Tochter Frieda ihn seiner Kriegsvergangenheit an der Ostfront wegen ins Kreuzverhör nimmt.
Frieda ist Historikerin, der Holocaust und die Verbrechen der Wehrmacht sind ihr Mission und Bürde. Mit dem selbstgerechten Gestus einer studentenbewegten Nachgeborenen will sie Theo auf Selbstbezichtigungs- und Entschuldigungskurs bringen, in der Hoffnung, sich selbst damit auf einen Streich befreien und dem Vater näherbringen zu können: „Er dagegen wollte vergessen, während ich seine Erinnerung zwingen wollte, sich zu artikulieren.“
Doch der in unterdrückter Gereiztheit und vorwurfsvoller Wortlosigkeit geführte Generationenkonflikt überdeckt nur ungenügend eine viel unmittelbarere Entfremdung zwischen Theo und Frieda, den Protagonisten in Anna Mitgutschs neuem Roman „Die Annäherung“. Die Geschichte setzt allerdings ein, als die schmerzhaftesten Grabenkämpfe zwischen den beiden schon längst in der Vergangenheit liegen. Theo ist inzwischen 96 Jahre alt, Frieda über 60. Und die Lebenseinsichten, die dem Greis nun kommen, sind weniger einer bewussten Auseinandersetzung als dem Nachlassen seiner Kräfte geschuldet.
Aufgrund seiner zunehmenden Hinfälligkeit entstehen Risse im Regelwerk seines wohlgeordneten Alltags mit seiner zweiten Ehefrau Berta. Eine junge ukrainische Pflegerin namens Ludmila kommt ins Haus der beiden Alten, und während sie bei Theo bald die Doppelrolle von später Liebe und Tochterersatz innehat, quält seine Frau und die leibliche Tochter die Eifersucht.
Anna Mitgutsch zeigt diesen Theo als schwachen, gutmütigen Mann, der sich zu oft durch schweigendes Dulden entzogen und sich stets zu sehr als Opfer gesehen hat, um sich selbst auch als Täter begreifen zu können: „Ein Nichts an der Front, ein Niemand vor den Schwiegereltern, ein Lasttier in der Arbeit, ein Versager vor seiner ersten Frau“.
Nach sechs Jahren Krieg glaubt er sich ein bisschen Glück verdient zu haben. Das beschert ihm nach dem Tod der ersten seine zweite Frau – um den Preis, die halbwüchsige trauernde Tochter ins Abseits zu stellen. Dass Frieda, die früh des Hauses verwiesen wird, zeitlebens mit schmerzlicher Zärtlichkeit um die Liebe ihres Vaters ringt, ist und bleibt ihm unangenehm, auch wenn er das Drama in Ansätzen durchschaut.
Der Konflikt zwischen Kriegs- und Nachkriegsgeneration als großes Thema der deutschsprachigen Literatur ist in den letzten zehn Jahren deutlich aus dem Fokus geraten. Vielleicht liest man Anna Mitgutschs Roman auch deshalb mit neu erwachtem Interesse. Aus zwei Blickwinkeln erzählt er die schwierige Vater-Tochter-Beziehung: in der dritten Person von Theo, aus Ich-Perspektive von Frieda. Dass deren Wahrnehmungen einander meist widersprechen, aber für sich genommen völlig schlüssig sind, betont nur noch, dass die Brüche zwischen den beiden nicht restlos zu kitten sind. Vage Einblicke in den jeweils anderen sind möglich, aber die im Titel angesprochene „Annäherung“ bleibt aus.
Und doch gibt Theo mit seinem Kriegstagebuch Frieda schließlich das, was sie immer haben wollte. Allerdings tut er es nicht um ihretwillen, sondern damit sie sich bereit erklärt, ihm seine Pflegerin Ludmila aus der Ukraine zurückzuholen.
Die Reise, die Frieda daraufhin widerstrebend gemeinsam mit einem alten Freund antritt, bringt weder die Erhellung der väterlichen Vergangenheit noch die erhoffte Einsicht. Die Annäherung, die ihr dabei dennoch gelingt, ist jene ans eigene, ewig mit sich selbst hadernde Ich.
Ruhig und leise erzählt Mitgutsch von den tiefsten Beschädigungen der Seele und von der Akzeptanz dessen, was der Fall ist. Darin liegt noch kein Glück, immerhin aber eine Erleichterung, unter der die Geister der Vergangenheit ein bisschen kleiner werden.
Am 30.3., 19 Uhr liest Anna Mitgutsch in der Alten Schmiede aus dem besprochenen Roman