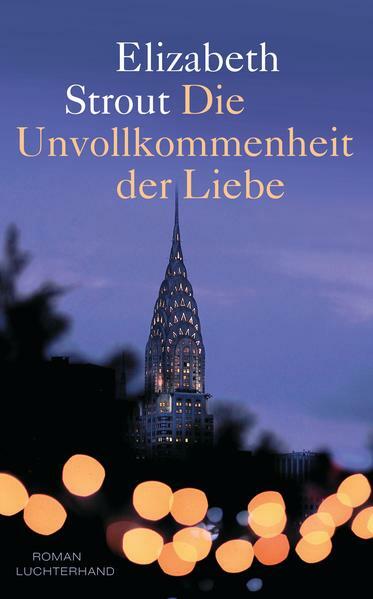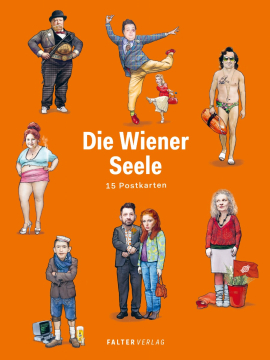Die Braut, die sich (nicht) traut
Julia Kospach in FALTER 41/2016 vom 12.10.2016 (S. 16)
Drei US-Autorinnen erzählen davon, wie man Ehen erträgt, an die Wand fährt oder auch zum Absprung nutzt
Die Leute halten Joan und Joe Castleman in der Regel für ein gutes Paar. Joan selbst erinnert sich nur noch vage. Ja, vielleicht, vor langer Zeit, „damals, als in Lascaux die ersten Höhlenmalereien an die Wände gekritzelt wurden“. Mittlerweile sind die beiden aber „in jenen von Algen durchzogenen Sumpf aufgebrochen, den man taktvoll als ‚zweite Lebenshälfte‘ bezeichnet“. Während eines Langstreckenflugs nach Europa blickt Joan auf ihren Mann und muss einsehen, dass sich ihre Ehe dem Ende zuneigt.
Die eierlegende Wollmilchsau
Wer davon noch nichts mitbekommen hat, ist Joe. Wie auch? Joe Castleman ist eine der wichtigsten Stimmen der US-Literatur, ein großer, erfolgreicher Autor und berühmter Mann und rundum mit sich selbst beschäftigt. In Finnland soll er nun den renommierten „Helsinki-Preis“ entgegennehmen, die wichtigste Literaturauszeichnung nach dem Nobelpreis. Es ist die ersehnte Krönung seiner Laufbahn. Gut 40 Jahre hat Joan diesem „klein gewachsenen, überdrehten Romancier mit Hängebauch“ die Hand und den Rücken frei gehalten, ihn begleitet wie ein Schatten, bei seinen zahlreichen Affären weggeschaut, seine Selbstzweifel zerstreut und seine Defizite ausgeglichen. Sie hat ihre eigene Schriftstellerkarriere im Sand verlaufen lassen und dafür Joes Lob ihrer unverzichtbaren Assistenzrolle hingenommen.
Joan war die eierlegende Wollmilchsau unter den Ehefrauen: klug, schön, talentiert, zurückhaltend. Nun, in ihren Sechzigern, mag sie sich nur mehr von Joe befreien. Ihr Blick auf ihn wird längst bestimmt von Spott, Hohn und Widerwillen. Diese Stimmungslage ist es auch, die sich in dem ironisch-ätzenden Ton widerspiegelt, in dem Meg Wollitzer, Jahrgang 1959, ihren Roman „Die Ehefrau“ erzählt.
Nicht dass die Geschichte von den Ehemustern des Patriarchats nicht schon viele Male erzählt worden wäre, und selbstverständlich existierten und existieren diese auch in den weltoffenen, links-jüdischen Kreisen der New Yorker Künstler- und Gelehrtenszene, in der Joan und Joe sich bewegen. Und wenn – wie dies hier der Fall ist – ein junger Literaturprofessor sich etwas mit seiner begabtesten Studentin anfängt und dann während der gemeinsamen Ehejahre zu Ruhm gelangt, sind die hierarchischen Verhältnisse ohnedies von Beginn an festgelegt.
Das Bestechende an Meg Wolitzers Version dieses Beziehungsklischees ist der Umstand, dass dieser Roman auf bissige Weise entlarvend und zugleich sagenhaft komisch ist. Ihre Protagonistin Joan beschreibt die Autorin als die „Subkultur der Frauen, die einfach dablieben“. Da findet keiner aus seiner oder ihrer angestammten Rolle, und Wolitzer verfügt über jenen scharfen, abgeklärten Blick, den es braucht, um das Erbärmliche und Gekünstelte am Ehe-Rollenspiel zu entlarven.
Ebenso aber wird das Tröstliche eines solchen Arrangements verschwiegen. Was die Beziehung über so viele Jahre zusammenhält, ist der „Luxus des Bekannten“. Eins muss man allerdings bedauern: Die Erzählung steuert ziemlich absehbar auf einen großen finalen Paukenschlag zu, den es nicht gebraucht hätte, um die Missverhältnisse im Ehegefüge von Joan und Joe zu verstehen und der dem Roman rückblickend einiges von seinem gleichermaßen bärbeißigen wie subtilen Charme nimmt.
Ganz anders verhält es sich mit Elizabeth Strouts Roman „Die Unvollkommenheit der Liebe“. Er ist von vorne bis hinten bruchlos meisterhaft. Sein Stil ist knapp, die Beziehungen sind brüchig und bitterarm die Familienverhältnisse in der entlegenen, von Feldern umgebenen Bruchbude im ländlichen Illinois, in der die Protagonistin Lucy Barton aufwächst.
Kargheit im Materiellen wie im Emotionalen steht im Fokus des Romans. Wie bei Wolitzer gibt es auch bei Strout eine ältere Frau, die vor allem deswegen bei ihrem Ehemann geblieben ist, „weil das in dieser Generation so üblich war“. Sie ist die Mutter der Ich-Erzählerin Lucy Barton. Für fünf Tage und fünf Nächte sitzt sie, die ihre Tochter jahrelang nicht gesehen hat, plötzlich an deren Krankenhausbett, während diese an einer seltsamen Infektion laboriert.
Aber dann verschwindet die Mutter wieder und kehrt zurück in ein Familienleben mit ihrem kriegstraumatisierten Mann und dem gemeinsamen erwachsenen, aber lebensuntüchtigen Sohn. Lucy wird von ihr erneut der Verbannung preisgegeben, in die sie geraten ist, weil ihre Sehnsüchte, ihr Studium und ihre Ambitionen als Schriftstellerin sie in den Augen der Familie zur Verräterin haben werden lassen. Ihren leisen, beharrlichen Aus- und Aufstiegswillen bestraft die Herkunftsfamilie mit Liebesentzug.
Was nicht zur Sprache gelangt
Was die Tochter die Mutter gern fragen und gern von ihr hören will, kann deshalb auch in der gemeinsamen Zeit im Krankenhaus nicht zur Sprache gelangen. Zu mächtig sind Scheu, Entfremdung und die Last unterschiedlicher Erinnerungen an Armut, Gefühlskälte und Missbrauch in Lucys Kindheit. Stattdessen erzählt die Mutter der Tochter, von deren Erwachsenenleben sie nichts wissen will, fast manisch „von lauter kaputten Ehen“ aus der früheren Nachbarschaft. Diese Beschreibung des Misslingens fremder Ehe- und Familienleben wird zum unbewussten Rechtfertigungsmonolog der Mutter, die keine Ahnung hat, wie sie ihrer Tochter sonst Zuneigung zeigen kann.
„Die Unvollkommenheit der Liebe“ beschreibt kurze, traurige Momente der Annäherung zwischen den beiden Frauen, deren Kontakt nach den fünf Tagen unversehens wieder abbricht. Eingebettet in dieses Kammerspiel vor Krankenhauskulisse ist Lucys ganze Lebensgeschichte. Ruhe findet diese nicht in ihrer ersten Ehe mit William, einem verständnisvollen Mann aus wohlhabenden Verhältnissen und Vater von zwei gemeinsamen Kinder, sondern erst in der Beziehung zu ihrem zweiten Mann, der wie sie in Armut und Lieblosigkeit aufgewachsen ist. Kargheit verbindet. Zugleich entwirft Strout das Porträt einer Frau, der gelingt, eine im Vergleich gar nicht so schlechte Ehe zu verlassen, weil diese ihrem ureigenstem Interesse, nämlich dem rabiaten Schreiben, im Wege steht.
Die große US-Autorin Anne Tyler hat ihren Eheroman „Die störrische Braut“ im Rahmen des „Hogarth Shakespeare“-Projekts geschrieben, für das international so bekannte und erfolgreiche Autoren und Autorinnen wie Margaret Atwood, Jo Nesbo, Edward St Aubyn oder Jeanette Winterson die Stoffe und Themen jeweils eines Shakespeare-Stücks neu erzählen. Tylers Buchtitel verrät, dass sie sich für „Der Widerspenstigen Zähmung“ entschieden hat (auch wenn der Titel des englischen Originals „Vinegar Girl“ etwas weniger eindeutig gewählt ist).
Die Tocher als Reservemutter
Das Setting von Tylers Shakespeare-Neuerzählung ist ganz lustig: Ihre Widerspenstige trägt den Namen Kate Battista, ist Ende 20, Aushilfskindergärtnerin, Tochter eines verschrobenen Johns-Hopkins-Forschers und – nach Abbruch ihres Studiums und dem Tod der Mutter – auch dessen Haushälterin und Reservemutter für die jüngere pubertierende Schwester.
Es ist, gelinde gesagt, eine eher unbefriedigende Existenz. Kate erfüllt ihre häuslichen und beruflichen Pflichten schlecht gelaunt, ambitionslos und mit wenig diplomatischem Geschick. Als ihr Vater mit dem Ansinnen an sie herantritt, sie solle zum Schein seinen weißrussischen Assistenten Pjotr heiraten, damit dessen Aufenthaltsbewilligung in den USA nicht abläuft, bevor das große wissenschaftliche Projekt des Vaters seinen Durchbruch erlebt, ist Kate entsprechend gekränkt und entrüstet.
Ganz offensichtlich wollte die Autorin in ihrer Neuerzählung der Frage auf den Grund gehen, warum sich Shakespeares selbstbewusste, widerständige Heldin im Lauf des Stücks zur gefügigen Ehefrau wandelt. In „Die störrische Braut“ erkennt die zum Heiraten vergatterte Braut, dass die Scheinehe zugleich das Exit-Ticket aus der Existenz als Ersatzmutter und -partnerin im väterlichen Haushalt ist und ihr den Absprung in ein selbstbestimmteres Leben eröffnet.
Frau kann sich, so sieht es Tyler, auf die überraschendsten Arten freispielen, und es ist angenehm zu lesen, wie sie Shakespeare so beschwingt eins vor den Latz knallt. Verglichen mit Tylers grandiosem Familienroman „Der leuchtend blaue Faden“ (2015) ist „Die störrische Braut“ allerdings deutlich als Auftragsarbeit und Fingerübung zu erkennen.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: