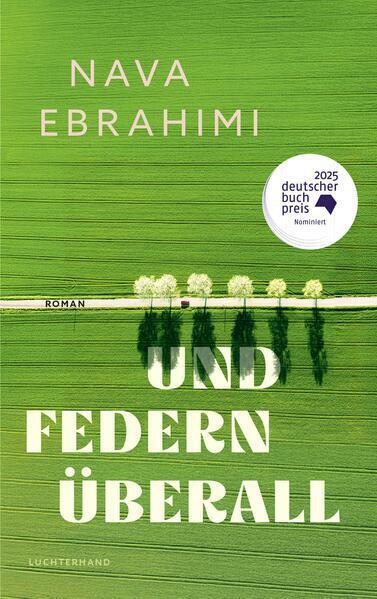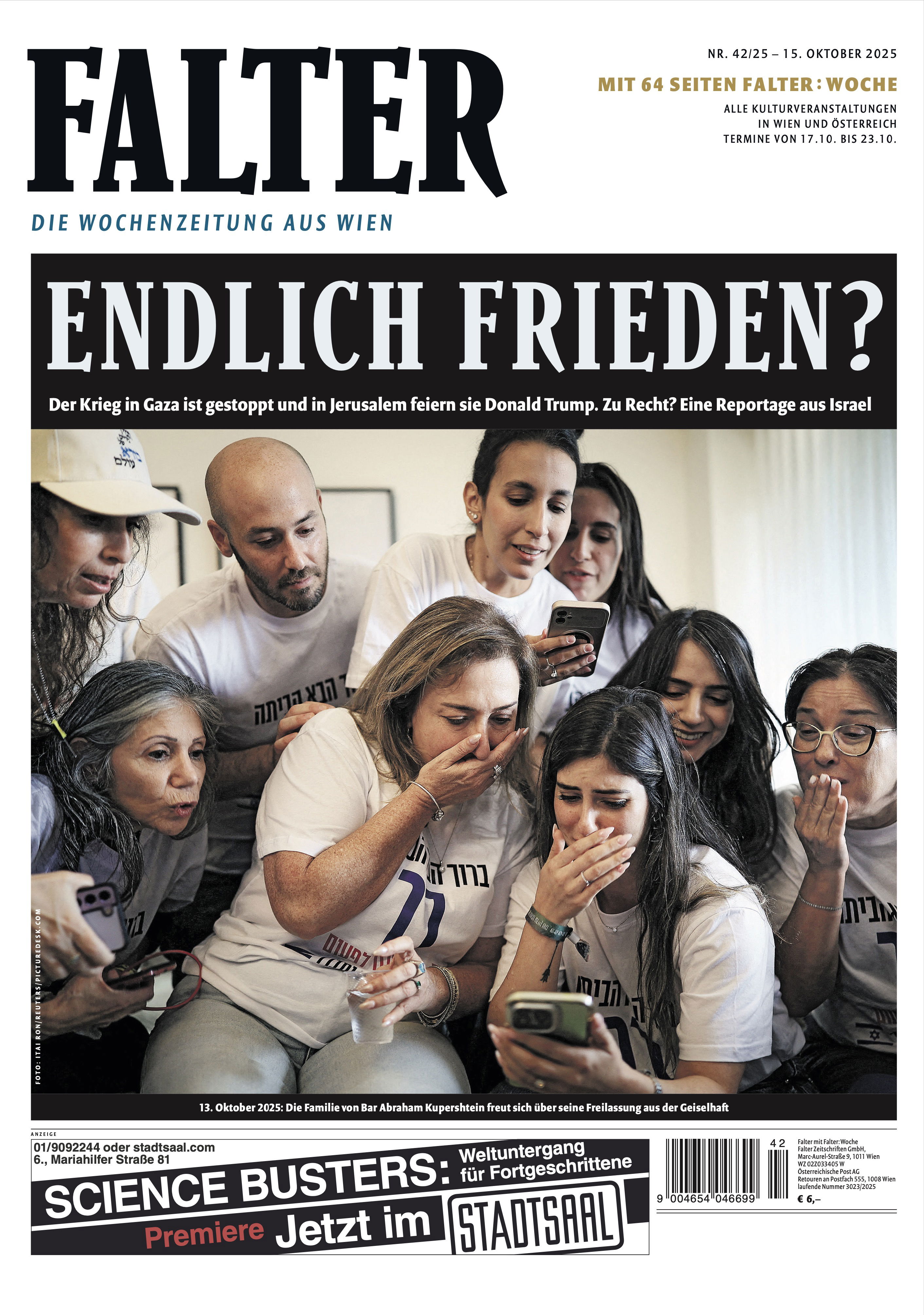
Von Hühnern und Menschen
Stefanie Panzenböck in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 6)
Wir sind Robinson Crusoes ohne Inseln“, lautet die erste Zeile des Gedichts „Entdecker der Trauer“. „Verloren in unserer Einsamkeit, sehnsüchtig aufeinander wartend, / dass wir uns wiederfinden, / weder ein Boot noch ein Meer“, heißt es dort weiter. Das Poem stammt vom afghanischen Lyriker Zia Ghassemi, wie im Anhang von Nava Ebrahimis Roman „Und Federn überall“ nachzulesen ist. Auf den 340 Seiten davor heißt der Verfasser allerdings Nassim. Er ist ebenfalls ein afghanischer Dichter. Als Flüchtling, der langsam erblindet, hofft er auf Asyl und glaubt, dies mithilfe seiner Gedichte leichter erreichen zu können.
Nassim, der in besonders ernsten Situationen besonders unpassende Witze reißt, ist einer von sechs Protagonistinnen und Protagonisten in Ebrahimis aktuellem Roman. „Und Federn überall“ erzählt einen Tag im Leben besagter Hauptfiguren, die alle in der emsländischen Kleinstadt Lasseren im Nordwesten Deutschlands wohnen. Im Zentrum des Geschehens steht die riesige Geflügelfabrik Möllring, in der 400 Hühner pro Minute geschlachtet werden. Die kurzen Kapitel sind jeweils einer Perspektive gewidmet, wobei sich die höchst unterschiedlichen Biografien der höchst unterschiedlichen Akteure im Laufe der Handlung immer mehr ineinander verwickeln.
Wegen des schwachen Endes, so viel sei verraten, muss man den Roman nicht lesen. Der Weg dorthin jedoch ist jede Minute wert. Ebrahimi taucht in Geschichte und Geschichten ein, beschreibt empathisch, spannungsreich und bisweilen humorvoll die Nöte der einzelnen Personen, die für eine ganze Gesellschaft stehen. Dass dabei Federn, der Schlachthof und die verhärtete Hühnerbrust („wooden breast“), die es am Fließband auszusortieren gilt, als Metaphern herhalten, ist stimmig.
Zu Beginn kommt Roshanak, das Alter Ego der Autorin und wie diese deutsch-iranische Schriftstellerin, ins Emsland, um Nassim bei der Übersetzung seiner Gedichte zu helfen. Der wiederum ist mit seinen Gedanken bei Justyna. Die beiden haben sich ineinander verliebt, können sich jedoch nicht vorstellen, zusammenzubleiben: Eine Beziehung zwischen einem afghanischen Asylwerber und einer älteren polnischen Haushaltshilfe hat hier wenig Aussicht auf Toleranz.
Über eine Dating-Website, auf der polnische Frauen und deutsche Männer in Kontakt treten, hat Justyna ein Rendezvous vereinbart. Merkhausen, ein Manager der Geflügelfabrik, bestellt sie gleich zu sich ins Büro, um gockelhaft seinen Erfolg auszustellen. Ihn beschäftigt außerdem ein Konflikt mit der ehrgeizigen jungen Unternehmerin Anna Seiwerth, die die Produktion optimieren und die Frauen am Fließband überflüssig machen soll.
Die stärkste Figur ist die Fabrikarbeiterin Sonia, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Sie will es sich verbessern und sich für die Lohnverrechnung bewerben. Als jedoch der Streit mit ihrer pubertierenden Tochter eskaliert, sperrt sie das Mädchen ein und verlässt die Wohnung. Am Ende bricht alles über ihr zusammen.
Das reale Vorbild für den fiktiven Ort Lasseren ist Haren, Sitz der Emsland Frischgeflügel GmbH von Möllring’schem Ausmaß. Viel interessanter ist jedoch der historische Hintergrund, den Ebrahimi gekonnt einbaut. Nach 1945 hieß Haren für kurze Zeit einmal Maczków. Die britische Militärregierung wies die deutsche Bevölkerung an, die Stadt vorübergehend zu verlassen und Platz zu machen für polnische „Displaced Persons“, die nicht mehr in ihre alte Heimat zurückkehren konnten oder wollten. 1948 gaben die Briten die Stadt schließlich an die deutschen Bewohner zurück. Die polnischen Familien mussten gehen.
Ebrahimi hat mit diesem historischen Verweis einen idealen Rahmen für ihren Roman gefunden – eine eindrucksvolle Parabel über die Angst vor Vertreibung und die Suche nach Heimat.