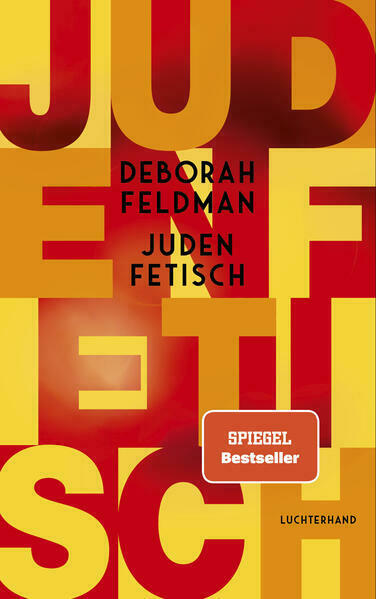Schtetlluft und Großstadtmief
Matthias Dusini in FALTER 49/2023 vom 06.12.2023 (S. 38)
Deborah Feldman macht Ärger. Sie legt sich mit Rabbinern an und nennt aus der ehemaligen Sowjetunion eingewanderte Juden respektlos "Kontingentflüchtlinge". Im Guardian warf sie den Berliner Regierenden vor, Widerspruch nicht zu dulden. "Deutschland ist ein guter Platz, um jüdisch zu sein. Außer man ist, wie ich, eine Jüdin, die Israel kritisiert."
Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober zeigte sie mit dem Zeigefinger auf die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. "Ich höre, was einige israelische Politiker öffentlich sagen, ohne es hinter PR-Phrasen zu verstecken: Sie wollen die Palästinenser vertreiben und vernichten", sagt sie im Falter-Interview, das im Hinblick auf ihre inzwischen abgesagte Lesung im Gartenbaukino stattfand.
Feldman, 1986 in New York geboren, schrieb mit "Unorthodox" einen Weltbestseller. Sie schildert darin ihre Kindheit in einer religiösen chassidischen Sekte im Vorort Williamsburg. Die Autorin wuchs bei ihren jiddisch sprechenden Großeltern auf, die den Holocaust in Europa überlebt hatten. Als 17-Jährige musste sie eine arrangierte Ehe schließen und bekam mit 19 einen Sohn. Heimlich las Feldman Romane und brach schließlich mit ihrer Gemeinde. Mit 26 Jahren veröffentlichte sie ihre Erinnerungen, die 2020 als Netflix-Serie verfilmt wurden.
Als Kind hatte Feldman nicht zehn, sondern hunderte Gebote zu befolgen. Englisch galt als zu weltlich und Popmusik als Sünde. Die vor den Nazis aus osteuropäischen Schtetln nach Amerika geflüchteten Satmarer Chassiden befolgen strenge Kleidervorschriften und meiden Rot als Farbe des Teufels. Vom Versprechen eines neuen Lebens angelockt, zog Feldman 2014 nach Berlin. Hier erwartete sie, ein rebellisches und emanzipiertes Judentum kennenzulernen: "Ich wollte mich als Jüdin neu erfinden." Beinahe zehn Jahre später hat sie einige Freunde.
Und viele Gegner.
Feldman antwortet, ohne zu zögern, und korrigiert ungenaue Fragen: "Nein, ich bin nicht im modernen Amerika aufgewachsen, sondern in einem mittelalterlichen Schtetl." Abwägende Einschübe wie "manchmal" und "sowohl als auch" gehören nicht zu ihrem Vokabular. So viel Selbstbewusstsein riskiert Widerrede.
Das Gewitter kündigte sich bereits im Sommer an, als Feldman ihren literarischen Essay "Judenfetisch" veröffentlichte. Die Erzählerin beschreibt darin das Eintauchen in das Berliner Geistesleben, in dem, wie sie feststellt, das Jüdische als etwas ganz Besonderes behandelt werde. Im ehemaligen Land der Täter hat sie den Eindruck, dass alle möglichst jüdisch sein wollen.
Feldmans Alter Ego schildert die Begegnung mit einem jungen Mann, der mit seinen jüdischen Wurzeln und Hebräischkenntnissen prahlte und später einräumte, dass alles nur erfunden war. Die Ich-Erzählerin trifft auf einen Rabbiner und erfährt, dass er Sohn eines bayerischen Pastors sei. Ausgerechnet dieser Konvertit will ihr den Weg zurück zum Judentum weisen. Sie staunt über die Suhrkamp-Verlegerin Ulla Schmidt, die den Künstlernamen Berkéwicz annahm, "weil eine spät entdeckte jüdische Großmutter anscheinend so hieß".
An zentraler Stelle berichtet sie von einem besonders bevormundenden, "spitzzüngigen" Schriftsteller, den die Zeit in einer Rezension als den Autor und Kolumnisten Maxim Biller identifiziert. Der Erzählerin dient diese Persönlichkeit dazu, den Typus eines "Papierjuden" zu beschreiben. Sie legt diesen Eindruck einem anonymen Gesprächspartner in den Mund, der sie über den biografischen Hintergrund von Menschen aufklärt, die nur auf dem Papier Juden seien.
Gemeint sind Zuwanderer aus der Sowjetunion, die weder Bezug zur jüdischen Kultur noch zum Holocaust hätten und aufgrund "irgendwelcher Scheine" als "Kontingentflüchtlinge" in Deutschland gelandet seien. In den 90er-Jahren nahm Deutschland Bürger der UdSSR auf, die im Pass die Nationalität "jüdisch" angeben. Zuerst schmunzelte die Erzählerin über diese Vorgänge, dann regte sich Widerspruch.
Verwundert verfolgte sie Kontroversen, in denen einer dieser "Papierjuden" einem Kollegen die Echtheit absprach. Eiferer durchforsten Stammbäume, um sogenannte Vaterjuden bloßzustellen. Da das Religionsgesetz Halacha nur Menschen mit jüdischer Mutter akzeptiert, gelten sogenannte Vaterjuden als halbe Portion. Das Staunen verwandelte sich schließlich in Ärger.
Die Autorin hatte mit ihrer Familie gebrochen, um den Zwängen der Identität zu entfliehen. Sie gab die jiddische Sprache und die Schtetl-Kultur auf, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und hat es nun mit Leuten zu tun, die nicht raus-, sondern unbedingt hineinwollen. Sarkastisch zuspitzend schreibt sie von "Bühnenjuden":"Sie performen ein parodiehaftes Judentum und erzählen vom Antisemitismus, weil man es von ihnen erwartete."
Ein Großteil der Community findet das nicht lustig. Mit ihren Spitzen gegen die "Kontingentjuden" stößt sie die allermeisten der rund 100.000 Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland vor den Kopf. Einige von ihnen mögen sich das Judentum im Kulturbetrieb als Orden umhängen, aber für die Mehrheit bedeutet der Davidstern die Erfahrung von Ausgrenzung. Auf dem Gebiet der Sowjetunion wurden 2,2 Millionen Juden Opfer der Shoah.
Der Verlust von Sprache und Religion geschah oft nicht freiwillig, sondern durch stalinistische Verfolgung. Als die Auswanderer in den 90er-Jahren nach Deutschland kamen, wurden sie nicht als Opfer antisemitischer Hetze, sondern als lästige Ausländer empfangen. Kontingentflüchtling Igor Levit, seit 1995 in Deutschland, drückte auf X seinen Unmut aus: "Eine old school Antisemitin aus Brooklyn, sich seit Wochen auf allen Kanälen in ihrem Israelhass ergehend, erklärt im herrischsten Ton gefühlte 90 % aller in Deutschland lebenden Juden zu Pseudojuden."
Feldmans Biografie macht es leichter, ihre Positionen zu verstehen. Für die orthodoxe Community ihrer Kindheit war die Shoah eine Strafe Gottes, die zu einem Leben voller Entsagung verpflichtete. Jedes körperliche Bedürfnis löste bei Deborah Schuldgefühle aus. Wenn sie Hunger hatte, dachte sie an die Großeltern, die im KZ noch mehr leiden mussten. Jene Lehrer, die besonders hart prügelten, bekamen von den Eltern die besten Bewertungen. Feldman entkam der Shoah-Obsession der Verfolgten und geriet - unter umgekehrten Vorzeichen -in die ebenfalls von Fixierungen und Neurosen geprägte Psyche der Enkel der Verfolger. Sie hat das Gefühl, dass das Judentum in Deutschland mitunter eine Projektion ist, ein Fetisch, der eher mit historischen Befindlichkeiten zu tun hat als mit Menschen aus Fleisch und Blut -ein Judentum ohne Juden. Sie plädiert für einen Humanismus, der die Rechte des Einzelnen über das Bekenntnis zur Gruppe stellt. Und spricht doch selbst über nichts anderes als über "J-Identität".
Feldmans Auftreten markiert auch einen Wandel. Sie macht sich zum Sprachrohr jüdischer Zuwanderer aus Israel und den USA. Allein in Berlin leben rund 12.000 überwiegend junge Israelis. Ihre Vorfahren waren Deutsche und Opfer der NS-Verfolgung, weshalb sie, so wie auch in Österreich, leicht einen deutschen Pass bekommen. Sofern sie es überhaupt wollen.
Sie sind Teil einer globalen Boheme, die das Image von Berlin prägt - als weltoffene und kreative Metropole. Man kommt hierher, um zu malen und zu tanzen. Nun mischen sich die politisch wachen Hipster eben auch in innere Angelegenheiten ein, die sie als ihre Angelegenheiten bestimmen. Das zeigt sich auch in der Distanz zur deutschen Regierung, die Israel zur Staatsräson erklärt. "Wenn man sich als Jüdin vorstellt, heißt es sofort: Wie stehst du zu Israel? Ich möchte nicht darauf festgelegt werden", erklärt Feldman.
Wenn Feldman für den Frieden mit den Palästinensern auf die Straße geht, meint sie damit auch: Sicherheit für alle in einem zunehmend von durchgeknallten Siedlern und ihren politischen Schutzherren beherrschten Land. Damit dort auch weiterhin säkulare, aufgeklärte Menschen leben können.
Die Skepsis wurzelt tief. Die Schriftstellerin wuchs in einer radikalreligiösen Umgebung auf, die den weltlichen Zionismus als Verrat an den messianischen Lehren der Bibel verwarf. Nach der Staatsgründung Israels 1948 prägten sozialistische Ideen das Selbstverständnis der Kibbuz-Nation, die bis 1977 linke Regierungen wählte.
Erst viel später kaperten Vertreter nationalreligiöser und rassistischer Ideen den Zionismus. Das orthodoxe Mädchen Deborah musste Israel zuerst hassen, weil die Nation zu wenig religiös war. Nun, da laut Feldman sogar die strenggläubigen Chassiden ihre Liebe zum Zionismus entdecken, erscheint der Abtrünnigen das Heilige Land als zu biblisch.
Kürzlich wurde bekannt, dass Candice Breitz, eine in Berlin lebende südafrikanische Künstlerin mit jüdischen Wurzeln, nicht ausstellen darf. Das Saarland-Museum sagte eine Schau von Breitz mit der vagen Begründung ab, sie habe "kontroverse Aussagen zum Gaza-Krieg" gemacht. Feldman kennt Breitz von gemeinsamen Aktionen. Unter dem Motto "We still need to talk" setzen sie sich für einen Waffenstillstand in Gaza ein.
Einige Institutionen reagieren auf das Engagement von Künstlerinnen und Künstlern mit Restriktionen. Sie streichen Ausstellungen, Preise und Auftritte von Leuten, die den Terror als Freiheitskampf verharmlosen -oder sich, wie Breitz, mit ihrem Menschenrechtsengagement weit aus dem Fenster lehnen. So sieht sich Feldman in ihrer Auffassung bestätigt, dass das vermeintlich freie Deutschland gar nicht so liberal ist.
Auf der Friedensdemo wähnte sie sich plötzlich von Polizisten umzingelt, einige Teilnehmer wurden sogar verhaftet: "Die Beamten waren so aggressiv, dass ich Herzrasen bekommen habe." Feldman berichtet außerdem von Rechtsextremen, die unbehelligt blieben. "Wenn man nicht dem Bild vom Judentum entspricht, wie Deutschland es gern hätte, wird man entsprechend behandelt." Sie fühlt sich gecancelt.
Was viele hinterfragen. Die Wochenzeitung Jüdische Allgemeine kritisiert das Fehlen von Belegen für Feldmans Thesen. Gecancelt werden trotz TV-Auftritten vor Millionenpublikum? Gerade in dem von ihr als proisraelisch gescholtenen Zentralrat der Juden in Deutschland fänden sich außerdem genügend Persönlichkeiten, die die Politik Netanjahus ablehnten.
In der Süddeutschen widerlegt Ronen Steinke, Autor von Büchern über Antisemitismus und Rechtsextremismus, Feldmans These von der "unbedingten Loyalität" Deutschlands gegenüber Israel. Hanna Veiler, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, ärgert sich auf Instagram: "Da kommt eine aus einer Sekte in Williamsburg und erklärt uns, dass Deutschland ein Paradies für Juden ist. Sieht sie nicht, dass der Antisemitismus seit dem 7. Oktober täglich zunimmt?"
Wie reagiert Feldman auf die Anwürfe?"Ich bin schon mehrmals durchs Feuer gegangen. Mit meinem ersten Buch habe ich in Amerika einen riesigen Shitstorm ausgelöst. Mir wurde mit dem Tod gedroht, Stalker haben vor meiner Wohnung gewartet. Nicht nur orthodoxe, sondern auch weltliche Juden haben mich als Antisemitin beschimpft. Ich weiß also, wie das auch psychologisch abläuft. Daher habe ich eine gewisse Resilienz entwickelt."
Absagen empfindet sie als policing discourse. Aus Angst vor unangenehmen Meinungen würden in Deutschland Leitplanken aufgestellt: "Diese Planken sind so eng, dass die Autobahn irgendwann nur noch aus einer Spur besteht."
Sie ruft dazu auf, sich nicht ängstlich hinter Verbotsschildern zu verstecken, sondern sich aufrichtig mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und beruft sich dabei auf den italienischen Schriftsteller und Holocaustüberlebenden Primo Levi: "Wenn man anderen Meinungen auferlegt, hat man damit nicht die Probleme gelöst."
Hinter Feldman steht keine Institution, die sie gegen Angriffe verteidigen könnte. Kein PR-Berater prüft wie bei anderen Promis die Interviewantworten. Sie steht für einen Typus öffentlicher Intellektueller, der für seine Überzeugung einsteht, selbst wenn es dafür Prügel gibt.
Man könnte Feldmans Bücher und Einlassungen als Teile eines großen Entwicklungsromans lesen, in denen Judentum und Holocaust schmerzliche Etappen darstellen. Die Geschichte beginnt in einem Schtetl in Williamsburg und führt in die Neuköllner Diaspora. Ziel der Reise: die Selbstfindung der Deborah Feldman.
Wenige Tage vor dem Termin strich das Gartenbaukino Feldmans Wien-Besuch. "Wir sehen es in der aktuellen Stimmung als unmöglich an, die Sicherheit und den Mehrwert einer solchen Veranstaltung zu gewährleisten", lautet die wenig befriedigende offizielle Begründung. So schlittert die Erfolgsautorin von der Überholspur auf den Pannenstreifen.