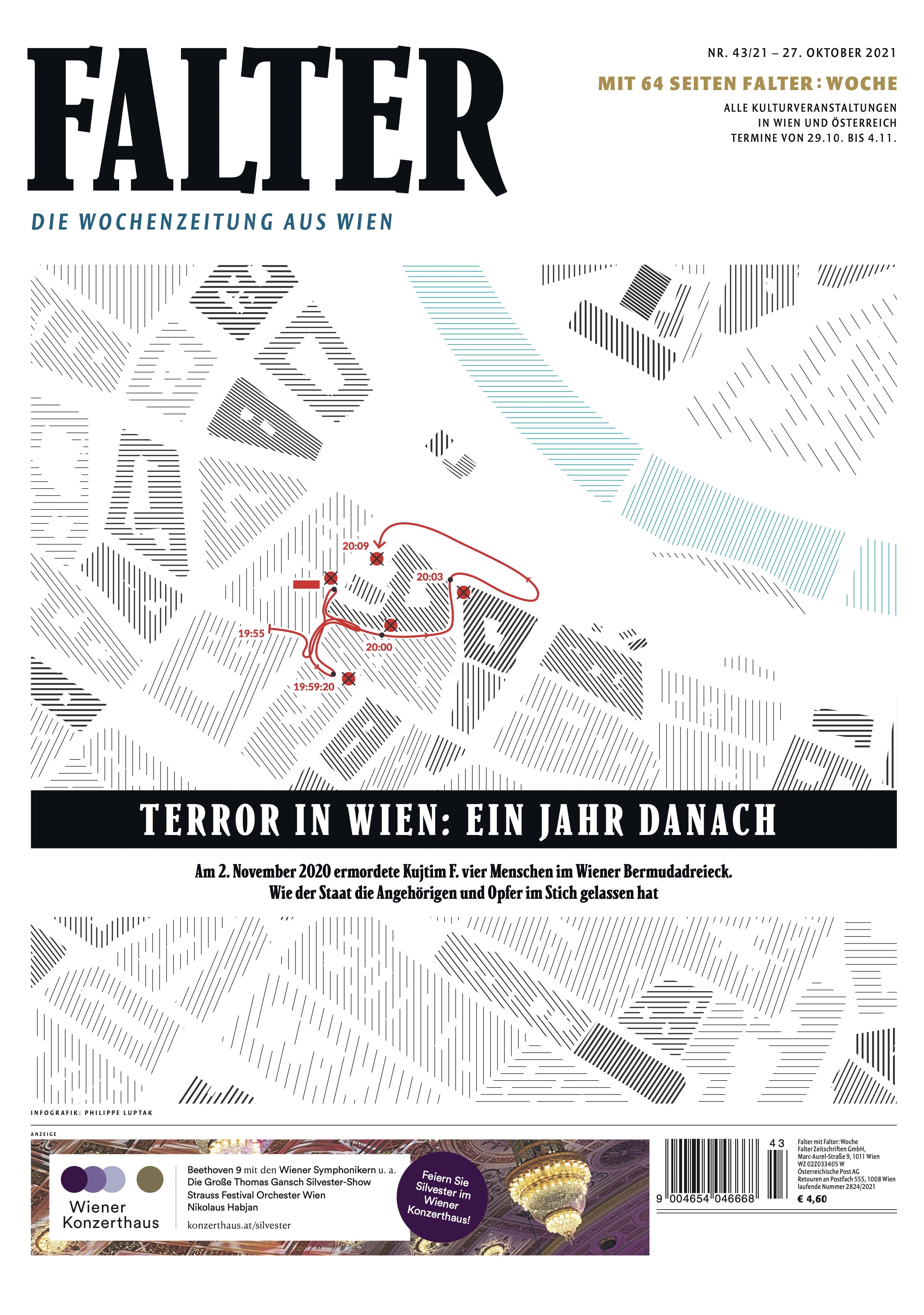
Polen und Ukrainer fürchteten, der Völkermord an den Juden könnte ihre Opfer überschatten
Rudi Klein in FALTER 43/2021 vom 27.10.2021 (S. 9)
Ein Panorama der drei Ethnien Galiziens, Polen, Juden und Ukrainer, steht am Anfang der regionalgeschichtlichen Studie. Auf dem Gebiet der heutigen Westukraine ermordeten die Nazis 1,5 Millionen Juden, nach 1945 setzte sich mit der Vertreibung von einer halben Million Polen die Tragödie fort, ebenso viele Ukrainer mussten Polen verlassen. Der Genozid wurde vergessen: „Vor allem Polen und Ukrainern lag daran, ihr Martyrium herauszustreichen. Sie fürchteten, der Völkermord der Nazis an den Juden könne ihre eigenen Opfer überschatten!“
Der Holocaust, erzählt und verdichtet wie sonst nie
Gerhard Zeillinger in FALTER 38/2021 vom 22.09.2021 (S. 22)
Omer Bartov arbeitet Geschichte und Wesen des Holocaust am Beispiel einer einst polnischen, heute ukrainischen Kleinstadt auf
In Buczacz, das heute in der Westukraine liegt, erinnert nichts mehr an die einstige polnisch-jüdische Geschichte. Die Orte des Todes, die Massengräber sind unbezeichnet, ein Interesse, sich der Vergangenheit zu stellen, ist nicht vorhanden. Dabei wurde in Buczacz neben bedeutenden Schriftstellern und Historikern auch Simon Wiesenthal geboren, aber nicht einmal seinen Namen findet man im örtlichen Heimatmuseum. Es ist, als hätte es nie Juden in dieser Stadt gegeben. Und das gilt für die gesamte Westukraine, das ehemalige Ostgalizien, sowohl was die hier verübten Massaker als auch was den Umgang mit der Geschichte betrifft.
Zwei Jahrzehnte hat der israelische Historiker Omer Bartov an dieser Studie gearbeitet, und so gut wie alles darin hat Modellcharakter: Buczacz steht beispielhaft für den Völkermord in Osteuropa, für die Verbrechen, die Deutsche und Ukrainer zwischen 1941 und 1944 an der jüdischen Bevölkerung verübten. Der Fokus auf diesen Ort hat ein familiäres Motiv: Bartovs Mutter hat ihre Kindheitsjahre in Buczacz verbracht. Während sie noch rechtzeitig nach Palästina auswandern konnte, hat von den zurückgebliebenen Verwandten niemand überlebt. Erst drei Jahre vor ihrem Tod hat die Mutter zu erzählen begonnen.
Es gibt in der Holocaustliteratur kaum ein intensiver recherchiertes Buch, das zugleich weit über eine nüchterne Dokumentation hinausgeht. Es ist vielmehr eine Erzählung, ein Zeugnis von Mordaktionen, wobei Bartov den berührenden Opfergeschichten die entsprechenden Täterbiografien gegenüberstellt. Sie können zumindest im Ansatz erhellen, was Menschen zum ganz gewöhnlichen, alltäglichen Morden befähigt hat. Ja, man muss geradezu von einer Wollust des Tötens sprechen.
Und dabei geht es nicht nur um die Verbrechen der Deutschen, es ist auch ein ukrainisches Problem, das bis heute weitgehend unreflektiert ist. Auch wenn nichts die deutsche Verantwortung relativieren kann, muss klar miteinbezogen werden, dass dieser Genozid nicht nur von einem Täter verübt wurde. Die Drecksarbeit erledigten allzu oft die unteren Chargen, ukrainische Hilfspolizisten, die man gar nicht erst dazu ermuntern musste.
Pogrome hatten im Osten Tradition, nicht selten waren es orthodoxe Priester, die dazu aufriefen. Dass zeitgleich zum Holocaust der ukrainische Nationalismus seine blutige Spur zog, ist kein Zufall, man arbeitete sich gegenseitig in die Hände. Die Kämpfer des ukrainischen Faschistenführers Stepan Bandera verfolgten ein klares Ziel: eine unabhängige Ukraine ohne Juden und Polen. Die Brutalität, mit der sie dabei vorgingen, ist auch eine Antwort auf die massive Polonisierung Ostgaliziens nach dem Ersten Weltkrieg. Aber nicht nur nationaler Hass war ausschlaggebend, oft war es blanke Gier, um sich etwa die Habe der Nachbarn anzueignen.
Die Deutschen hatten andere Motive. Für die vielen Polizisten, Gestapobeamten und SS-Männer, die hier Dienst versahen, war das Morden wie ein "Urlaubserlebnis", eine Abwechslung in ihrer Karriere, und sie wurden auch reichlich belohnt: "Lebensmittel, Alkohol, Tabak und Sex standen ihnen fast unbegrenzt zur Verfügung", für drei Jahre waren sie "die uneingeschränkten Herren über Leben und Tod".
Nachher hatten sie kaum etwas zu befürchten. Von 106.000 Personen, gegen die BRD-Gerichte später ermittelten, wurden nur 6500 verurteilt, lediglich 166 zu lebenslanger Haft. Das "staatlich gelenkte Massenverbrechen", so Bartov, bietet "reichlich Anschauungsmaterial dafür, dass bei einem Genozid die Mörder in der Regel davonkommen".



