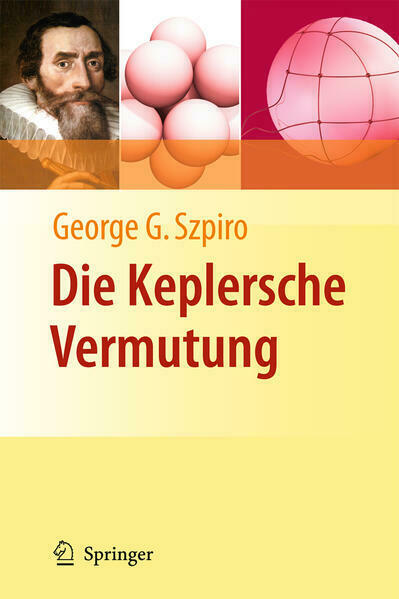Leichter lässt sich die Diktatur berechnen
Martina Gröschl in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 39)
George G. Szpiro schildert an zwei Beispielen, wie sich die Mathematik mit Lösungen plagt
Wir alle stimmen darin überein, dass dieser Beweis hässlich ist." Mit wenig schmeichelhaften Worten kommentierte der US-Mathematiker Sam Ferguson einen Beweis, an dem er selbst mitgearbeitet hatte. Das ist sicherlich eine ungewöhnliche Reaktion auf die Lösung eines Problems, das fast 400 Jahre die mathematische Kollegenschaft auf Trab gehalten hatte und sogar auf David Hilberts berühmter Liste der wichtigsten im 20. Jahrhundert zu lösenden mathematischen Probleme stand, die dieser beim Internationalen Mathematikerkongress in Paris im Jahr 1900 vorstellte.
Die "Hässlichkeit" des Beweises war jedoch nicht das Einzige, was die Mathematik-Community vom Freudentaumel als der sonst üblichen Reaktion auf die Lösung eines Problems solchen Ranges abhielt. Zwölf Experten wurden nach Bekanntgabe des Beweises auf dessen Überprüfung angesetzt. Fünf Jahre später gaben sie auf. Es sei zwar zu 99 Prozent sicher, dass der Beweis richtig sei, eine komplette Zertifizierung sei seinem Team aber nicht gelungen, so der Teamleiter Gábor Fejes-Tóth in seinem Abschlussbericht. Was in aller Welt war da geschehen?
Das Rätsel der Orangenpyramide
Sieben Jahre nach der englischen Originalausgabe und genau 400 Jahre nach der Formulierung des Problems durch den Astronomen Johannes Kepler ist nun George G. Szpiros "Die Keplerscher Vermutung" auf Deutsch erschienen. Die Keplersche Vermutung ist, wenn man keinen Wert auf mathematische Exaktheit legt, schlicht und einfach mit Hausverstand zu lösen: Sie besagt, dass die platzsparendste Art, Kugeln zu stapeln, vom Prinzip her jene der Orangenpyramide von Obsthändlern ist.
Da bekannterweise Hausverstand nicht als mathematischer Beweis durchgeht, machten sich im Laufe der Jahrhunderte Mathematiker mit allerlei Methoden an die Lösung des Problems – und scheiterten kläglich. Ihre leidvollen Erfahrungen begleitet George G. Szpiro, routinierter Verfasser zahlreicher populärwissenschaftlicher Bücher zum Thema Mathematik, bis zu jenem "hässlichen" Beweis, den der US-Mathematiker Thomas Hales unter Mitarbeit des eingangs zitierten Sam Ferguson im Jahr 1998 vorgelegt hat.
Wobei das Buch sehr lesefreundlich gestaltet ist: Haarige mathematische Passagen sind gekennzeichnet und können bei Bedarf übersprungen werden. Grafiken erklären auf einen Blick, wo tausend Worte nur große Fragezeichen auslösen. Ein umfassendes Literatur-, Personen- sowie Sachverzeichnis gibt nicht nur Hilfestellung, wenn einem die zahlreichen Protagonisten wie Begriffe im Laufe der Lektüre verlorengehen, sondern auch Hinweise, wo vertiefende Betrachtungen nachgelesen werden können, sofern Bedarf danach besteht.
Dass sich dieser Bedarf außerhalb der einschlägigen Fangemeinde in Grenzen halten könnte, liegt nicht an Szpiros kompetenter und mit angemessenem Humor gewürzter Darstellung. Die Lösung der Keplerschen Vermutung ist, und das scheint in der Natur der Sache zu liegen, eine mehr mühsame als spannende Angelegenheit. So zitiert Szpiro seinen Popularisierungskollegen in Sachen Mathematik Ian Stewart, der dem Beweis der Keplerschen Vermutung sinngemäß den Charme eines
Telefonbuchs zusprach.
Die Lösung wurde letztendlich dem Computer überantwortet, was auch zum Problem der nicht 100-prozentigen Zertifizierung führte, da es den Gutachtern schlicht und einfach nicht möglich war, jeden einzelnen Beweisschritt zu überprüfen, und man nie weiß, ob sich beim Computer während des Rechnens nicht unbemerkt ein Fehler einschleicht. Selbst Thomas Hales hatte von seinem zu guter Letzt mehrere hundert Seiten umfassenden Beweis anscheinend einmal genug. Zumindest kam er der Bitte der Gutachter, die Beweisdarstellung für die Überprüfung ein wenig lesbarer zu machen, nicht nach.
Mathematik und der Computer
Was das Buch in jedem Fall trotz der Mühsal der Angelegenheit absolut lesenswert macht, ist neben Szpiros gelungener Darstellung, dass es wie selten ein anderes auf die zeitgenössische und potenzielle künftige Arbeitsweise der Mathematik und ihr Verhältnis zum Computer eingeht. Denn dieses ist weniger eng, als man annehmen möchte. Es ist eine Sache, den Computer für die Lösung numerischer Probleme oder als Hilfsmittel bei der Suche nach Beweisideen einzusetzen. Ihn aber direkt für die Beweisführung zu verwenden heißt in letzter Konsequenz, die Mathematik zu einer Experimentalwissenschaft zu machen. Was vielen Mitgliedern der Mathematik-Community gar nicht behagt.
Als Reaktion auf die nicht gelungene Zertifizierung seines Beweises hat Thomas
Hales das Projekt "Flyspeck" ins Leben gerufen, im Zuge dessen der Beweis der Keplerschen Vermutung mithilfe des Computers schrittweise und lückenlos bis in den letzten Winkel durchgearbeitet werden soll. Die deutsche Ausgabe von Szpiros Buch ergänzt zwar, was seit Erscheinen der Originalausgabe geschehen ist, das Projekt ist jedoch auf 20 Jahre ausgelegt, eine mögliche Jubelbotschaft werden wir also erst Mitte der 2020er-Jahre vernehmen.
Ist bei der Verifizierung der Keplerschen Vermutung zumindest das vielzitierte Licht am Ende des Tunnels zu sehen, gibt es beim Einsatz der Mathematik in demokratischen Belangen keinerlei Anlass zur Hoffnung auf eine befriedigende Lösung. Das macht den Titel des zeitgleich erschienenen Buchs "Die verflixte Mathematik der Demokratie" desselben Autors programmatisch.
Mathematik und Demokratie
Wer schon bei der Keplerschen Vermutung Schwierigkeiten hatte, sollte von diesem Buch definitiv die Finger lassen. Die Problemstellung, welches Wahlverfahren das fairste ist und wie in Demokratien Parlamentssitze vergeben werden sollen, führt nicht nur zu der wenig befriedigenden Erkenntnis, dass die am leichtesten zu berechnende Staatsform die Diktatur ist, sondern auch dazu, dass es bis heute weder ein 100-prozentig gerechtes Wahl- noch Zuordnungsverfahren gibt und wahrscheinlich auch nie geben wird.
"Die verflixte Mathematik der Demokratie" ist kein Buch für Menschen, die Lösungen brauchen. Demgemäß lesen sich George G. Szpiros letzte Sätze: "Am Ende dieses Buches kommen wir zu der traurigen Schlussfolgerung, dass die verflixte Mathematik der Demokratie nicht verschwindet." Wer dieses Buch liest, muss also Freude am Prozess des Ringens haben. Dieser wird, von Platon bis zu den gegenwärtigen Visionen zum Thema anhand der historischen Protagonisten und ergänzt durch Kurzbiografien ausgiebig dargestellt. Immerhin hat das Thema einen Vorteil: nämlich dass die Mathematik der Wahl- und Zuordnungsverfahren im Großen und Ganzen mit den Grundrechnungsarten auskommt und damit auch für mathematisch weniger Versierte kaum Verständnisprobleme aufwirft.
Gleichzeitig machen Szpiros Ausführungen schmerzhaft klar, in welchem Ausmaß für die Gesellschaft wichtige Entscheidungen vom benutzten mathematischen Verfahren abhängen. So ist wohl den wenigsten Menschen bewusst, dass die US-Präsidentschaftswahl zwischen
George W. Bush und Al Gore im Jahr 2000 anders ausgehen hätte könnten – auch wenn man die kolportierten Wahlunregelmäßigkeiten beiseite lässt.
Es konkurrieren nämlich bei der Zuteilung der Anzahl der Abgeordneten, die einen Bundesstaat im Repräsentantenhaus vertreten können, mehrere Verfahren, die einmal den einen, einmal den anderen Bundesstaat bevorzugen. Da das Repräsentantenhaus zusammen mit dem Senat den Kongress bildet und die Zahl der Wahlmänner pro Bundesstaat der Zahl der Repräsentanten im Kongress entspricht, wäre mit einem anderen Zuordnungsverfahren als dem angewandten damals Al Gore Präsident der Vereinigten Staaten geworden.
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: