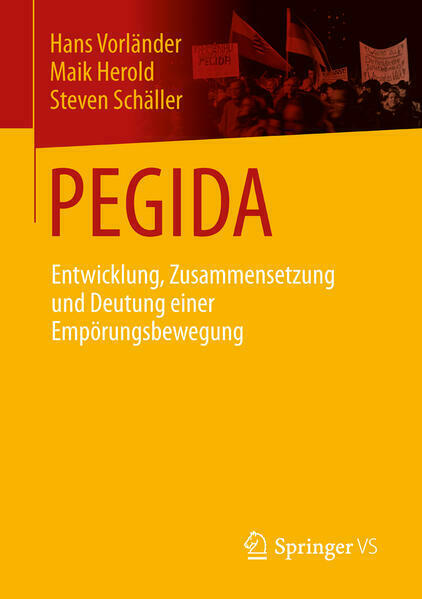Deutschland auf dem Weg zur Zwei-Drittel-Demokratie
Christine Zeiner in FALTER 7/2016 vom 17.02.2016 (S. 16)
Politologen der Technischen Universität Dresden legen eine Studie über Pegida und deren Verbindungen zur AfD vor
Ein Montagabend in Dresden, wenige Tage nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo. „Lieber aufrecht zu Pegida – als morgen auf Knien nach Mekka“ steht auf einem Schild, das durch die Innenstadt getragen wird. Ein Mann nickt anerkennend: „Die lassen sich jede Woche was einfallen, die geben sich richtig Mühe“, sagt er im Vorbeigehen.
Vor einem Jahr hatte die Protestbewegung Pegida, gemessen an den Teilnehmerzahlen, den vorläufigen Höhepunkt erreicht. Bis zu 25.000 selbsternannte „Patriotische Europäer“ demonstrierten in Dresden gegen die „Islamisierung des Abendlandes“. Dann wurden es wieder weniger, bis Angela Merkel angesichts steigender Flüchtlingszahlen „Wir schaffen das“ verkündete. Dennoch: Pegida verbuchte aus verschiedenen Gründen nicht mehr den Erfolg vom letzten Winter – auch nicht am Samstag Anfang Februar. Die Organisatoren hatten versucht, das nachzuholen, was bisher gescheitert war: Pegida zu einer europäischen Massenbewegung zu machen.
Man kann die „Patriotischen Europäer“ also als ein paar Verirrte ansehen, und in Relation zur Gesamtzahl der deutschen Bevölkerung stimmt das auch. Pegida aber strahlt auf Deutschland aus. Unser Nachbar war zwar auch nie eine Insel der Seligen, der Anteil von Menschen mit fremdenfeindlicher Einstellung ist hier etwa so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Doch fremdenfeindlich aufzutreten galt 70 Jahre lang im Grunde als tabu. Pegida änderte das. Die etablierte Politik bleibt davon nicht unberührt. Dazu gibt Pegida Wahlempfehlungen für die nationalkonservative und zumindest rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD).
Stammtisch auf der Straße
Es ist also nicht irrelevant, sich mit dem Phänomen Pegida zu beschäftigen. In dem soeben erschienenen Band „Pegida“ gehen Politikwissenschaftler der Technischen Universität Dresden der Frage nach der Zusammensetzung und Entwicklung der „Empörungsbewegung“ nach, die aus einer Facebook-Gruppe entstanden ist und zum ersten Mal Ende Oktober 2014 in Dresden demonstrierte.
300 bis 400 Teilnehmer waren es am Anfang. Von Montagabend zu Montagabend wurden es mehr. Daran hatte auch die Berichterstattung einen Anteil – die Medien stürzten sich auf die zunächst unerklärbare Truppe mit dem schrägen Namen, die nicht nur aus den, wie es die Autoren formulieren, „sozialen Rändern der Gesellschaft“ besteht. Pegida sammelt bei weitem nicht nur jene, die „über einen niedrigen Bildungsgrad verfügen und durch rechtsextremes Gedankengut motiviert“ seien.
„Auch wir dachten am Anfang, das kann doch nicht sein, dass hier auch Leute mit einer Hochschulbildung mitlaufen und Leute, die gut verdienen“, sagte Politologe und Buchautor Hans Vorländer kürzlich in einem Pressegespräch. Sämtliche Studien aber hätten gezeigt, dass „alle dabei sind, Bürgerliche ebenso wie Hooligans und Skinheads“, ein „Stammtisch auf der Straße“. Bemerkenswertes Ergebnis der Untersuchungen: Ein Teil der Teilnehmer hört sich demnach die hetzerischen Reden gar nicht richtig an. Man schwelge im kollektiven Protesterlebnis. Andere, so Vorländer, nähmen die Reden in Kauf. Es gebe eben keine andere Plattform des Protestes.
Sächsisches Selbstbewusstsein
Aber warum gerade Sachsen, warum Dresden? Es dürfte an den selbst- und traditionsbewussten Bewohnern liegen und außerdem an der medientauglichen Kulisse der Stadt. Vorländer spricht von einer „grundkonservativen, bürgerlichen Stimmung“ in Sachsen, man sei „empfänglich für Bewegungen, die das Unbekannte und das Fremde ablehnen“.
Im Buch ist zugespitzter die Rede von einem „Ausweis eines besonders unverhohlen gepflegten ethnokulturellen Zentrismus“ und „einer Art sächsischen Chauvinismus, der mit der Selbstüberhöhung der eigenen Gruppe und einer starken Setzung von Etabliertenvorrechten einhergeht“. Will man die Besonderheiten der Dresdner verstehen, muss man auf die Geschichte Sachsens schauen. Das schließt die Bombardierungen vor 71 Jahren mit ein, die bereits die Nationalsozialisten für sich zu vereinnahmen wussten: das schöne Dresden als einzigartiges Opfer. Die Autoren gehen darauf, wenn auch nur kurz, ein.
Etwas mehr Raum bekommt die Verbindung von Pegida und AfD – ein besonders lesenswertes Kapitel, legte die AfD doch in den Umfragen zuletzt enorm zu. Mitte März könnte sie es in drei weitere Landtage schaffen. In fünf Landesparlamenten und im EU-Parlament ist sie bereits vertreten. Sollte sie 2017 in den Bundestag einziehen, gäbe es dort nach langer Zeit wieder eine Partei rechts der Konservativen. Einer der Hauptgründe dafür, dass es für die AfD gut läuft, liegt am Thema Flüchtlinge: „In der derzeitigen Migrationsfrage gibt es im repräsentativen, politischen Raum keine Opposition“, sagt Politologe Vorländer. Die AfD sei der „einzige Blitzableiter“ – und Pegida sei das auf der Straße.
Wolfgang Merkel, Politologe am Wissenschaftszentrum Berlin, sah Deutschland schon vor einigen Jahren auf dem Weg zur „Zwei-Drittel-Demokratie“. Auch Hans Vorländer und seine Koautoren sprechen im „Pegida“-Band von einem „immer größer werdenden Potenzial politisch Enttäuschter“. Die Politik reagierte bisher unter anderem mit einem verschärften Asylgesetz. Im Buch wird auf eine „erschreckende Normalisierung ungehemmter fremdenfeindlicher Auswirkungen und aggressiver Elitenschmähung“ verwiesen, „insbesondere in den sozialen Netzwerken“.
Aus Pegida könnte aber am Ende auch etwas anderes, Positives entwachsen sein, nämlich eine „Frischzellenkur der Demokratie“. Optimistisch sind die Autoren aber nicht.