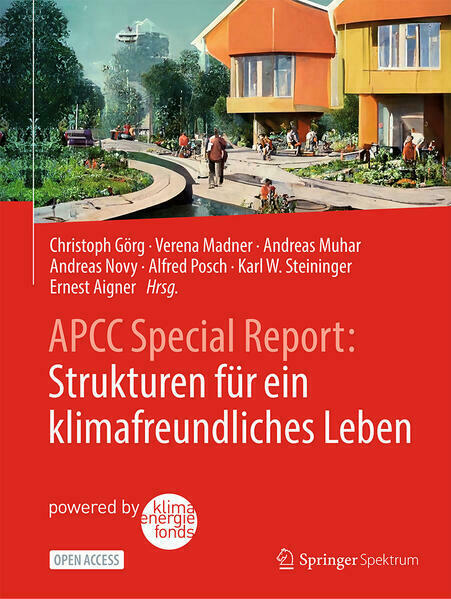"Wir brauchen eine Allianz der Mutigen"
Paula Dorten in FALTER 39/2023 vom 27.09.2023 (S. 44)
Was braucht Österreich, damit die Menschen hierzulande klimafreundlich leben können? Das ergründete die heimische Klimaforscher-Community in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Herausgekommen ist ein monumentales Werk mit 28 Kapiteln, an dem 80 Autoren und 120 Qualitätssicherer mitgewirkt haben. Diese Woche ist es als Buch erschienen.
Sozialökonom Andreas Novy wirkte federführend am Report mit -und nimmt vor allem die Politik in die Pflicht.
Falter: Herr Novy, warum ist es derzeit in Österreich so schwer, klimafreundlich zu leben?
Andreas Novy: Weil die Rahmenbedingungen schlecht sind. Wer in Wien lebt, hat zum Beispiel in der Regel eine Gasheizung -und die wenigsten Wiener haben sich freiwillig dafür entschieden. Wer auf dem Land lebt, für den ist wiederum eine gesellschaftliche Teilhabe ohne Auto oft schwierig. Österreich ist gebaut: Straßen, Leitungen, Gebäude - allein indem man die bestehende Infrastruktur nützt und instand hält, verursachen die Menschen hohe Emissionen. Dazu kommt der individuelle Konsum noch drauf. Selbst für Asketen ist es deshalb kaum möglich, in Österreich klimafreundlich zu leben.
In Ihrem Bericht weisen Sie darauf hin, dass Österreich weltweit eigentlich für mehr Emissionen verantwortlich ist, als offiziell angegeben werden. Können Sie das bitte erklären?
Novy: Ja, das liegt an der Art der Messung, die für Österreich sehr vorteilhaft ist. Ganz viel von dem, was wir konsumieren und was unser Leben attraktiv macht, importieren wir -zum Beispiel die Textilien aus Bangladesch oder die Handys und Laptops aus China. Würden wir die Emissionen unserer importierten Waren in unsere Bilanz einrechnen, wären die Emissionen in Österreich um ein Drittel höher. In weiterer Folge heißt das, dass auch unsere Anstrengungen für den Klimaschutz noch einmal größer sein müssen.
Eine Hauptaussage Ihres Berichts lautet: Für ein klimafreundliches Leben müssen wir die Strukturen ändern, nicht den Menschen. Warum?
Novy: Weil Strukturen schon da sind, bevor die Menschen handeln. Ein Beispiel: Menschen sprechen Deutsch, weil es die deutsche Sprache gibt. Das heißt, wir bedienen uns einer bestehenden Struktur. Genauso ist es beim Verkehr. Die Österreicher fahren nicht mit dem Auto, weil sie sich immer schon mit einem Verbrennungsmotor fortbewegen wollten, sondern weil sie in eine Autogesellschaft hineingeboren wurden. Die Politik sollte deshalb viel mehr Augenmerk auf diese Strukturen und Rahmenbedingungen legen, weil sie eben vorgelagert sind.
Worauf liegt das politische Augenmerk derzeit?
Novy: In der öffentlichen Debatte geht es bis heute oft um den nachhaltigen Konsum. Diese Debatte ist extrem moralisierend und auf das Individuum ausgerichtet. Wer sich zum Beispiel fürs Klima einsetzt, aber mit dem Auto fährt, gilt als Heuchler. Aber was gibt uns das Recht, einem Menschen, der in Zwettl oder in Güssing wohnt, zu sagen, er wäre ein schlechter Mensch, weil er 15.000 Kilometer im Jahr fährt? Wenn alles am Einzelnen liegt, überfrachtet ihn das mit Verantwortung. Zäumt man diese Debatte aber von der anderen Seite auf und lenkt sie auf die Rahmenbedingungen, entlastet das letztlich die Menschen. Es geht dann plötzlich darum, dass die Entscheidungsträger mutige Entscheidungen treffen müssen.
Wer sind denn die Entscheidungsträger, die ein klimafreundliches Leben in Österreich ermöglichen können?
Novy: Zentral sind es staatliche, politische Institutionen. Sie können Gesetze beschließen und dafür sorgen, dass die fossile Infrastruktur zurückgebaut und durch eine ersetzt wird, die ein klimafreundliches Leben fördert. Damit sich die Rahmenbedingungen in diese Richtung ändern, braucht es den Druck von zivilgesellschaftlichen Initiativen. Und natürlich spielen auch Bildung, Wissenschaft und Medien eine bedeutsame Rolle.
Gerade sieht es so aus, als verließe die Politik der Mut. Der britische Premier verkündete vergangene Woche, die Klimaschutz-Ambitionen zurückzuschrauben. In Deutschland war das klimafreundliche Heizungsgesetz massiv umkämpft, am Ende gab es nur einen schwachen Kompromiss. Was braucht es, damit Politiker mutiger werden?
Novy: Die Zustimmung zur Klimapolitik hängt sehr stark daran, sie auch als eine soziale Herausforderung zu sehen. Eine gesicherte Grundversorgung für alle ist dabei ganz wichtig für die gesellschaftliche Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen. In unserem Bericht wird stark betont, dass wir einen gerechten Übergang brauchen, damit alle an einem klimafreundlichen Leben teilhaben können.
Was bräuchte es für diesen klimagerechten Wandel?
Novy: Die Politik muss die Daseinsvorsorge gewährleisten und sie für alle ökologisch bereitstellen: Dazu zählen etwa leistbare öffentliche Verkehrsmittel oder auch die Unterstützung für gering verdienende Haushalte, damit auch diese ihre Heizungen auf Erneuerbare umstellen können und raus aus Öl und Gas kommen.
ÖVP und Grüne haben sich in einem Entwurf für ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz darauf verständigt, die Ära der Öl-und Gasheizungen sozial gerecht zu beenden. Die ÖVP-Energiesprecherin gab Mitte September bekannt, das Gesetz neu verhandeln zu wollen. Wenige Monate zuvor bezeichnete Bundeskanzler Karl Nehammer in seiner Zukunftsrede Österreich als "Autoland" und setzte sich für den Erhalt des Verbrennungsmotors ein. Was denken Sie über diese Politik?
Novy: Für mich persönlich war die Rede des Kanzlers klimapolitisch hoch besorgniserregend. Nicht nur, weil sie zum Teil fachlich falsch war. Sondern vor allem, weil der Kanzler und damit seine Partei einen Schwenk vollzogen hat. Er hat damit klargemacht, dass es in Österreich neben der FPÖ nun mit der ÖVP eine zweite Partei gibt, die sagt: "Klimapolitik ist uns nicht wichtig." Wenn diese zwei Parteien eine solche Position vertreten, muss man damit rechnen, dass sie jene Maßnahmen nicht umsetzen werden, die die Forschung als notwendig benennt.
Warum positionieren sich die Rechten so gegen den Klimaschutz?
Novy: Von Trump über Bolsonaro bis hin zur FPÖ ist es den Rechten geglückt, einen Kulturkampf zu inszenieren, in dem die Klimapolitik zu einem attraktiven Nebenschauplatz geworden ist. Egal ob es die Themen Gender, Migration oder Klima betrifft, ihre Behauptung lautet immer: "In einer Zeit des schnellen Wandels garantieren wir euch, dass sich für euch nichts ändert." Und das ist, ganz ehrlich gesagt, eine sehr attraktive Botschaft - auch wenn sie wissenschaftlich nicht haltbar ist.
Was kann man dieser attraktiven Botschaft entgegenhalten?
Novy: Das Gegen-Narrativ muss viel breiter sein als Worte wie "Dekarbonisierung" oder "Klimaneutralität". Wenn den steigenden Heizkosten solche abstrakten Begriffe entgegengesetzt werden, dann verstehe ich, dass die Botschaft in der Bevölkerung nicht ankommt. Darum muss die Klimaforschung das Thema von Sicherheit und Alltagssorgen deutlich ernster nehmen. Sie muss zeigen, dass Klimaschutz für ein sicheres Leben notwendig ist. Wenn wir das Beste unserer Heimat, unseres Lebensstils bewahren wollen, dann ist es unsere Verantwortung, bestimmte Dinge umgehend zu verändern. Zum Beispiel müssen wir die Bodenversiegelung stoppen, damit heimische Singvögel nicht aussterben und wir dem Hochwasser nicht hilflos ausgeliefert sind. So eine Erzählung wäre durchaus auch für Konservative ansprechend.
Hat die Klimaforschung bisher zu technisch argumentiert?
Novy: Die Klimaforschung hat sicherlich nicht ausreichend genug darauf hingewiesen, dass es in der Klimakrise nicht darum geht, das Klima zu retten, sondern uns Menschen zu schützen. Sie hat also zu wenig empathisch für die Alltagssorgen der Menschen argumentiert. Ich glaube, dass unser Bericht über die klimafreundlichen Strukturen da hilfreich ist, weil er zu einer anderen Erzählung beiträgt. So eine Erzählung richtet sich auch an die Menschen, denen das Klima kein intrinsisches Anliegen ist, und macht klar: Die Klimakrise betrifft euch! Es ist für euch schlecht, wenn wir Böden versiegeln, und es wird bei euch zu Hangrutschungen führen. Es geht um eure Heimat, um eure Kinder. Es ist euer Urlaubsort am Mittelmeer, der zu heiß wird. Wir haben deshalb das Konzept des klimafreundlichen Lebens als ein gutes Leben für alle definiert. Klimafreundliches Leben heißt also, dass die Politik das Leben der Menschen durch Klimaschutz verbessern kann - vor allem auch für diejenigen, die am unteren Rand der Gesellschaft sind.
Derzeit läuft die Klimadebatte anders. Die Leute fürchten sich davor, dass man ihnen das Schnitzel, das Auto, den Urlaub verbietet. Braucht es diese Verbote?
Novy: Verbote sind ja nichts Neues, egal ob im Verkehr, in der Migration oder beim Klima: Für eine wirksame Politik brauchen wir immer alle Maßnahmen -dazu zählen eben auch Verbote. Aber die Geschichte vom Schnitzelverbot ist lächerlich. Ich wüsste nicht, wer den Menschen das Schnitzel verbieten will. So etwas werden Sie auch in unserem Bericht nicht finden. Klar ist aber auch, dass das Schnitzel nur wegen bestimmter steuerlicher, negativer Subventionen so billig ist. Über Futtermittel-Import-Beschränkungen könnte man schon ernsthaft nachdenken. Das hätte wiederum zur Folge, dass gegebenenfalls auch die Preise fürs Schnitzel raufgehen. In den seltensten Fällen geht es im Klimaschutz aber um wirkliche Verbote. Beim Thema Auto geht es zum Beispiel in erster Linie darum, klimaschädliche Förderungen abzubauen. Wir zitieren in unserem Bericht eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts, das berechnet hat, dass die klimaschädlichen Förderungen jährlich über vier Milliarden Euro ausmachen. Dazu zählen das Pendlerpauschale, die Vergünstigung von Dienstwagen, der verbilligte Diesel und andere emissionserhöhende Förderungen. All dies fördert klimaschädliches Verhalten.
Die Liste an offenen Vorhaben der Koalition aus ÖVP und Grünen ist noch lang, dieser Regierung bleibt noch maximal ein Jahr. Welches ihrer Vorhaben wäre für das klimafreundliche Leben in Österreich am wichtigsten?
Novy: Der Spezialbericht wurde von der österreichischen Forschungsgemeinschaft erstellt. Wir folgten dabei den Prinzipien, die auch der Weltklimarat anwendet: Wir bewerten im Bericht nicht die Tagespolitik, sondern geben bloß Handlungsempfehlungen für die Politik insgesamt. Eines wird aber dessen ungeachtet auch im Bericht festgehalten: Die Lage ist so ernst, dass es nicht die eine Wundermaßnahme gibt, die uns rettet. Und es ist auch keine Zeit für ideologische Vereinfachungen: Wir brauchen die Technik, aber wir brauchen auch politische Rahmen, um emissionsärmer leben und arbeiten zu können. Wenn Sie mich persönlich fragen: Es braucht gleichzeitig vieles: ein Klima-und ein Bodenschutzgesetz, die auch Sanktionen vorsehen, ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz -you name it. Am wichtigsten wäre aber eine belastbare Allianz der Mutigen und Willigen, um mit vielen kleinen Initiativen und ein paar großen Würfen ernsthaft den Umbau anzugehen. Sprich: Transformation by design, bevor wir von der Wirklichkeit überrollt werden.
Radikale Klimaaktivisten kleben sich wegen einer eher kleinen Forderung auf die Straße: Sie wollen ein strengeres Tempolimit, also 100 statt 130 km/h auf der Autobahn. Was halten Sie von dieser Forderung?
Novy: Gerade weil diese Forderung so bescheiden ist, ist sie für mich von so großer Bedeutung. Denn sie ist ein Indiz dafür, wie ernst es die Politik mit dem Klimaschutz meint. Zwar bekennen sich bis auf die FPÖ alle Parteien zu den internationalen Klimazielen. Aber die Politik sendet doppelte Botschaften aus. Durch ihr Nein zu Tempo 100 vermittelt sie: "Es ist ja eh nicht so ernst." Aber wenn selbst große Teile von Regierung und Opposition das Problem nicht ernst nehmen, warum sollen dies dann die Menschen tun?
Im Bericht stellen Sie fest, dass die Politik im Klimaschutz insgesamt zu langsam ist. Sie erwähnen darin auch die Sozialpartner, die dem klimafreundlichen Leben bislang keinen hohen Stellenwert beigemessen haben - vor allem die Wirtschaftskammer gelte als "beharrende Kraft".
Novy: Ja, wir benennen, dass die Wirtschaftskammer in der Klimapolitik eine eher unrühmliche Rolle hat - auch wenn sich selbst der Wirtschaftskammer-Präsident zu den Pariser Klimazielen bekennt und die großen Anstrengungen der Industrie lobt, um die Ziele zu erreichen. Im Bericht konnten wir kein abschließendes Urteil über die Rolle der Wirtschaftskammer fällen, weil Forschungen zur aktuellen Politik noch ausstehen. Doch meine ich persönlich, dass die Kluft zwischen großen Versprechen und fehlenden Taten gerade bei der Wirtschaftskammer groß ist -was dem Klimaschutz nicht nützt.
Der Zivilgesellschaft schreibt der Bericht hingegen eine wichtige Rolle für eine klimafreundliche Zukunft zu. Mitte September waren mehr als 20.000 Menschen für den Klimaschutz auf Österreichs Straßen. Kann die Zivilgesellschaft mit solchen Massendemos noch etwas erreichen?
Novy: 2019 hat die "Fridays for Future"-Bewegung einen unglaublich positiven Effekt gehabt. Wie sie das Klima in die Schlagzeilen gebracht hat, war großartig. Vermutlich wird dieses Agenda-Setting so schnell nicht wieder gelingen. Was aber nicht heißen soll, dass die Aktivisten nicht trotzdem weitermachen sollen. Die Funktion solcher großen Demonstrationen ist ein Stück weit ja auch eine Selbstvergewisserung: "Ich bin nicht alleine und es gibt viele, denen der Klimaschutz wichtig ist."
Wie kann die Zivilgesellschaft am wirksamsten werden?
Novy: Es gibt derzeit eine Gefahr für die Gesellschaft: Durch die zunehmende Individualisierung zerfällt sie in immer mehr Milieus. Es gibt eine Tendenz, im Wesentlichen in dem eigenen Milieu zu kommunizieren und zu leben. Das macht Kompromisse und gesellschaftliche Allianzen viel schwieriger. Ich würde Klimaaktivisten dazu raten, die Energien in milieuübergreifende Bündnisse zu stecken. Wichtiger, als sich mit Gleichgesinnten auf einer Demo zu vergewissern, wäre es, Gemeinsamkeiten zu finden zwischen Stadt und Land, zwischen dem rot-grünen Milieu und aufgeschlossenen Konservativen.
Derzeit beschäftigt die Öffentlichkeit vor allem der polarisierende Protest der "Klimakleber". Bringt er etwas?
Novy: Die Letzte Generation fordert mit gewaltfreien Aktionen sehr bescheidene Maßnahmen. Ihre Aktionen sind demokratisch so legitim wie die der Frauen, die vor 100 Jahren für ihr Wahlrecht kämpften, oder der Schwarzen in den USA, die vor 60 Jahren gleiche Rechte einforderten. Ob ihre Aktionen aktuell -und in dieser Medienlandschaft -das Klügste sind, bleibt offen und wird erst die Geschichte zeigen. Aber es ist ein Faktum, dass dieser Protest von Lawand-Order-Parteien dazu missbraucht wird, von ernsthaftem Klimaschutz abzulenken.
Kommen wir zum Abschluss auf die Hauptaussage Ihres Berichts zurück: Die klimafreundlichen Rahmenbedingungen sind wichtiger als das Verhalten des Einzelnen. Was kann man aber als Einzelner tun, um wirkmächtig zu werden?
Novy: Unser Bericht will die Aufmerksamkeit verschieben - weg vom Verhalten hin zum Gestalten. Konkret heißt das zum Beispiel, sich dafür zu engagieren, dass das Dorfzentrum revitalisiert wird und es wieder ein Wirtshaus im Ort gibt. Das schafft eine Struktur, die das Verkehrsaufkommen senkt. Oder setzen Sie sich in der Nachbarschaft dafür ein, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Das ist auch ein Gegengift gegen diese fragmentierte, in Silos organisierte Gesellschaft. Menschen sind nicht bloß Konsumenten, sondern auch Bürger. Es braucht also engagierte Einzelne, die zusammen mit anderen klimafreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Das schließt aber nicht aus, sich auch innerhalb der gegebenen Strukturen so klimafreundlich wie möglich zu verhalten.