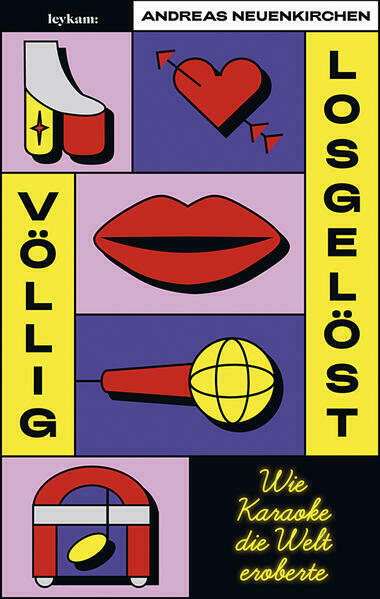Die Kulturgeschichte des Karaoke: richtig schlecht singen
Lina Paulitsch in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 34)
Wer schon einmal in einer Karaoke-Bar zum Mikro gegriffen hat, muss loslassen können -und zwar Scham, Perfektionismus und jegliches Gefühl der Peinlichkeit. So lautet die titelgebende These des anregenden Buches "Völlig losgelöst". Der deutsche Autor Andreas Neuenkirchen arbeitet in anekdotischen Kapiteln die Kulturgeschichte des Mitsingens auf. Neuenkirchen lebt selbst in Japan, dem Ursprungsort des Karaoke. In Asien war Singen schon immer ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Zu jedem Anlass gibt es ein Ständchen, Firmen haben eigene Hymnen, Ampeln und Bahnhöfe ihre Melodien. Dagegen war es in Europa lange Zeit verboten zu singen. Volkslieder galten im Mittelalter als frivol, als verbunden mit Trunkenheit und anderen weltlichen Freuden. So ist es nur folgerichtig, dass Karaoke nicht im Westen, sondern in Japan entstand.
1967 inspirierte Shigeichi Negishi eine persönliche Marotte. Negishi leitete eine Firma für Elektrobauteile in Tokio. Und er sang bei der Arbeit leidenschaftlich gern mit, wenn das Radio lief. Leider traf er nie die richtigen Töne, was ihm seine Mitarbeiter eines Tages höflich mitteilten. Negishi glaubte ihnen kein Wort und ließ kurzerhand ein Gerät bauen, das die Instrumentalversion eines Songs und seine Stimme per Mikro verstärken sollte. Er wollte sich selbst hören können. Geboren war die erste Karaoke-Maschine der Welt.
In seinem Buch erklärt Neuenkirchen ein popkulturelles Phänomen, das von der Geschichte ganz Asiens erzählt. Zum Beispiel, wie die Japaner während der Olympischen Spiele 1988 Karaoke nach Südkorea mitbrachten. Und so an der Entstehung des heute weltweit bekannten K-Pop beteiligt waren.
Atemlos durch die Nacht
Lale Ohlrogge in FALTER 4/2025 vom 22.01.2025 (S. 35)
Ein Mann sitzt allein an der Bar, vor ihm ein großes Bier, in der Hand ein Mikrofon. "Come on, party people, throw your hands in the air", nuschelt er hinein. Keiner folgt seiner Anweisung. Der Kellner starrt auf den Kassencomputer, die Frau drei Hocker weiter putzt ihre Brille, und das Paar beim Eingang streitet sich auf Serbisch. Einzig die flimmernden Disco-Lichter scheinen heute in Partystimmung zu sein.
Doch Matthias, den Mann am Mikrofon, stört das nicht. "Mir geht es vor allem ums Singen und um den Spaß." Angst vor Peinlichkeiten hat der ITler keine, und das, obwohl er sich selbst als schüchtern beschreibt. Aber beim Karaoke ist eben alles anders, weil er hier "einfach mal aus sich herauskommen kann".
Mit seiner Begeisterung ist er nicht allein. Seit der Pandemie erlebt das Amateursingen einen regelrechten Boom. So berichten es zumindest Karaoke-Maschinen-Verleiher, Experten und Barbetreiber. Doch wie ist es um die hiesige Szene bestellt?
Walzer, Oper und Knabenchor, Wien ist die Stadt der Musik. Aber wo kommen die Spaßsolisten und Pseudoperformer auf ihre Kosten? Was schätzen sie an Karaoke?
Wie so viele Geschichten beginnt auch diese in der Lugner City. Neben "Raucherparadies" und "Relaxzone" befindet sich die Mai Kai Karaoke-Bar. Das Lokal ist eine wichtige Anlaufstelle. Zum einen, weil hier wirklich jeden Abend gesungen wird. Und zum anderen, weil hier in den vergangenen Jahren gleich zwei Weltrekorde im Dauerkaraoke aufgestellt wurden. 2006 sangen die Bargäste ganze 142,5 Stunden. Das sind fast sechs Tage. Ein Jahr später dann der Sieg im Solo, bei dem der Sänger Brian über 38 Stunden durchhielt. Organisiert wurde das damals vom Karaoke Club Austria, dieser hat heute über 800 Mitglieder.
Doch das ist alles ziemlich lange her. So wirkt es zumindest, wenn man sich an einem Mittwochabend in das Lokal begibt. Am Wochenende sei es hier voller, beteuert der Kellner, doch heute sitzen außer Matthias, dem singenden Informatiker, nur sieben weitere Gäste hier. Eine von ihnen ist Daniela, 67, kurze Haare, Indoor-Vaper, Bier. Auch sie ist eine leidenschaftliche Sängerin, obwohl sie selbst von sich behauptet: "Ich habe Beine fürs Radio und eine Stimme fürs Ballett." Schlimm sei das nicht. "Hauptsache Stimmung. Darauf kommt es an", findet die Pensionistin, die seit 20 Jahren regelmäßig Karaoke singt.
Daniela ist damit fast eine Pionierin, denn mit Karaoke ging es in Österreich erst in den 90ern los. Seitdem ist die Begeisterung ungebrochen. Vielleicht auch, weil es selbst in einer Großstadt wie Wien nur wenige Orte gibt, wo es in Ordnung, nein, gar erwünscht ist, sich ein bisschen lächerlich zu machen. In einer Karaoke-Bar kommt es auf das Mindset an -spaßbereit und schambefreit. Die Stimme ist zweitrangig.
The Karaoke-Company, ein großer britischer Verleiher von Karaoke-Maschinen, berichtet, dass gerade während der Corona-Lockdowns die Anfragen in die Höhe geschnellt seien. Es kam sogar eine neue Zielgruppe hinzu: Vor der Pandemie seien die Kunden vor allem ältere Menschen und Pubbetreiber gewesen. Inzwischen buchen immer mehr junge Menschen die Maschinen für ihre Hochzeiten und Partys.
Die erste Karaoke-Maschine kam 1967 auf den Markt. Shigeichi Negishi, der Chef einer japanischen Firma für Unterhaltungselektronik, sang leidenschaftlich im Radio oder Fernsehen mit - bis seine Mitarbeiter ihm beichteten, dass er keinen einzigen Ton treffe. Um sich selbst hören und bewerten zu können, schloss Negishi kurzerhand ein Mikrofon ans Radio an. Dann ließ er einen Mitarbeiter an einem 8-Spur-Kassettendeck tüfteln, um die Instrumentalversion eines japanischen Schlagers herauszufiltern. Der Ingenieur baute einen quadratisch-glitzernden Kasten mit Lautsprecher, Mikrofon und Münzschlitz - und Negishi tingelte mit der ersten Karaoke-Maschine der Welt durch Tokio. Die Songtexte gab es auf Papier dazu. Reich wurde er mit seiner Erfindung nicht. Er hatte kein Patent auf seine Maschine angemeldet.
Gerade das beförderte den globalen Siegeszug des Amateursingens: Die Maschine wurde tausendfach kopiert. Einer der Profiteure war etwa Daisuke Inoue. Er brachte 1971 die sogenannte "8 Juke Box" auf den Markt, für die er 2004 gar den Ig-Nobelpreis bekam, also den Spaßnobelpreis für Frieden, der an der Universität Harvard verliehen wird. Er habe "eine völlig neue Art und Weise geschaffen, wie Menschen lernen können, sich gegenseitig zu tolerieren", so die Begründung des Publizisten Marc Abrahams, der die Preise vergibt. Inoue hatte begonnen, seine Geräte an Lokale zu vermieten -die Karaoke-Bar war geboren .
Streng genommen zählt Jo&Joe in Wien nicht zu diesen Etablissements. Es ist ein Hostel, direkt über dem Ikea am Westbahnhof. Dennoch zählt die Lobby der Backpacker-Herberge zu den Karaoke-Hotspots der Stadt - zumindest für die hiesige Queer-Szene, die sich hier seit drei Jahren jeden Mittwoch zum Drag-Karaoke zusammenfindet.
Queer ist vor allem die Songauswahl der Gäste. Die Girl-Bands der frühen 2000er seien besonders beliebt, sagt Dragqueen Ryta Tale, die die Veranstaltung regelmäßig moderiert. "Als Schüler wurde uns gesagt, dass diese Musik schwul ist. Man hat die Spice Girls also heimlich gehört", erzählt Ryta Tale, die selbst in einem kleinen Dorf im Burgenland aufgewachsen ist. "Indem man heute Wannabe offen auf der Bühne singt, holt man sich das alles wieder zurück."
Über die Jahre sei ihre Veranstaltung immer größer und beliebter geworden. Ryta Tale glaubt, dass der aktuelle Karaoke-Hype auch mit dem Weltgeschehen zusammenhängt: "Man hat das Gefühl, die Welt geht gerade unter und dass eh schon alles egal ist. Wer sich da noch über eine schiefe Stimme aufregt, hat ein Problem."
"Hello everybody, welcome to karaoke!", begrüßt die gut 1,90 große Drag-Künstlerin Metamorkid das Publikum. Sie vertritt an diesem Mittwochabend Ryta Tale. Bevor es losgeht, erklärt Metamorkid die Spielregeln. Erstens: "Have fun! Nobody cares." Zweitens: "Don't choose a song with the N-word in it." Drittens: "Don't be rude." Gwen und Sarah tänzeln zur Bühne. Die beiden sind ebenfalls angehende Dragqueens und stellen sich daher auch nur unter ihren Künstlernamen vor. Sie singen "Be a Hoe/Break a Hoe" von Shirin David und Kitty Kat. Die Hip-Hop-Nummer mit rasanten Beats und flottem Sprechgesang ist zweifelsohne nur etwas für Karaoke-High-Performer.
Gwen und Sarah hüpfen durch den Saal, schicken dem Publikum Luftküsse zu und treffen dabei jeden Ton. Der vorläufige Höhepunkt des Abends vollzieht sich, als Sarah dem Publikum den Hintern zustreckt und gekonnt den "Booty shakt". Die Menge grölt.
"Das Prinzip von Karaoke lautet: Es soll Spaß machen", sagt Andreas Neuenkirchen. Er ist Journalist und hat die Geschichte des globalen Mitsingens aufgearbeitet. Sein Buch "Völlig losgelöst" - der Titel ist dem Karaoketauglichen Song "Major Tom" entlehnt - wird im März im Leykam-Verlag erscheinen. Karaoke sei vor allem in den ostasiatischen Ländern ein fester Bestandteil der Alltagskultur, sagt Neuenkirchen. Der Deutsche lebt seit 2016 in Tokio.
"Singen spielt in der japanischen Gesellschaft eine große Rolle", erzählt Andreas Neuenkirchen per Zoom. "Die meisten Firmen und Schulen haben eigene Hymnen, es wird zu vielen Anlässen gesungen. Anders als in christlichen Ländern, wo es historisch immer wieder verboten war zu singen, gibt es in Japan keine Berührungsängste mit dem Spaß, der mit dem Singen kommt."
Auch im Westen begann der Karaoke-Siegeszug in den asiatischen Communitys, als große Elektronikfirmen wie JVC oder Pioneer in den 80er-Jahren ihre Maschinen in die Chinatowns der US-Großstädte verkauften. Bald stimmte die US-Mehrheitsgesellschaft mit ein. "Und was es in Amerika gibt, kommt auch nach Europa", sagt Neuenkirchen. Befeuert wurde all dies von der Digitalisierung.
Angefangen bei Singstar, einem Karaoke-Spiel für die Playstation, das den in den späten Nullerjahren vorherrschenden Ego-Shooter-Spielen ernsthafte Konkurrenz machte, bis hin zu Karaoke-Apps wie Smule, auf der heute monatlich 52 Millionen User ihre eigenen Videos bekannter Hits teilen. Oder auch Youtube, wo es so gut wie jeden Song als Karaoke-Version gibt.
Kulturell stellte Karaoke auch die Weichen für den Erfolg der Castingshows der 2000er-Jahre. Wie in der Stammbar konnten die Amateursänger selbst bekannte Lieder wählen, die sie Jury und Publikum vortrugen. Karaoke live im Fernsehen.
Eine fiese Jury gibt es im Jazzclub Mio in Wien-Ottakring nicht, und selbst wenn: Niemand müsste sich fürchten, denn hier können wirklich alle singen. Reynaldo Pernes etwa. Der 59-jährige Musiker ist ein großer Fan von Frank Sinatra und hört sich auch genauso an. Die Töne, das Gefühl, die Performance, alles genauso wie beim alten amerikanischen Meister, einzig das Outfit ist anders: Hat der Ottakringer Sinatra doch Smoking und Fliege gegen Daunenjacke und Goldkette eingetauscht.
In seinem Heimatland, auf den Philippinen, sei Karaoke so etwas wie Volkssport, sagt Pernes, der vor über 30 Jahren nach Wien kam. "Dort geht es auch viel um Wettbewerb", sagt der Mann und schlägt dabei seine Fäuste gegeneinander. Auf den Philippinen gibt es viele Karaoke-Contests in Bars und im Fernsehen, es winken hohe Preisgelder.
Auch Pernes probt manchmal noch, bevor er zum Singen in den Jazzclub kommt. Zu gewinnen gibt es hier zwar nichts, zu verlieren allerdings die Würde vor den anderen philippinischen Profi-Amateuren. Das bestätigt auch May Ammin, 35, die wie Pernes fast jedes Wochenende im Jazzclub Mio verbringt: "Bei uns auf den Philippinen ist Karaoke einfach überall."
Egal, ob man sich mit Freunden auf ein Bier trifft, mit der Mutter einen Kaffee trinken geht oder zuhause herumhängt - das nächste Mikrofon sei immer nur einen Handgriff entfernt. Selbst auf der Straße gebe es Karaoke-Automaten, zum schnellen Trällern im Vorbeigehen.
Welche Songs am liebsten gesungen werden, variiert von Land zu Land, trotz Globalisierung. Laut Karaoke-Experte Neuenkirchen gibt es ein paar Evergreens -"Bohemian Rhapsody" von Queen oder "Sweet Caroline" von Neil Diamond -, meistens stehen aber nationale Schlager in den Top Ten. In Deutschland und Österreich: Helene Fischer mit "Atemlos durch die Nacht", auch Rammstein ist trotz Skandalen vorn mit dabei. Oder eben 80er-Hits wie "Major Tom".
Auf den Philippinen steht "My Way" von Sinatra hoch im Kurs. Zwischen 2002 und 2012 wurden deshalb dort auch insgesamt zwölf Menschen ermordet, erzählt Buchautor Neuenkirchen. Zu den Motiven zählten etwa eine zu lange Wartezeit, weil "Möchtegern-Sinatras das Mikrofon nicht hergeben wollten", oder der gerissene Geduldsfaden eines Wachpostens, der einen talentlosen Sänger mit seiner Dienstwaffe erschoss. Weil er das Lied einfach nicht mehr hören konnte.
Die "My Way"-Morde sind im Jazzclub Mio weit weg. Die Stimmung ist heiter, und die Tische füllen sich mit leeren Bierflaschen. "Singen ist einfach meine Leidenschaft, es tut mir gut, und ich vergesse meine Probleme", sagt Pernes, nachdem er schon zum dritten Mal an diesem Abend Frank Sinatra gesungen hat.
Das, was er hier fühlt, hat medizinische Gründe. Singen stimuliert das autonome Nervensystem: Man entspannt sich, fühlt sich wohl und erholt sich. Auch Hemmungen verschwinden. "In der Musiktherapie kann man Leute, die sehr in sich gekehrt sind, aus sich herauslocken", sagt Autor Neuenkirchen. "Singen gibt Selbstvertrauen."
Karaoke hat aber auch dunkle Seiten -zum Beispiel den "Karaoke-Zwang". In Japan ist es üblich, mit Firmenkollegen zu singen. Das kann zu Druck und Stress führen. "Die heilende Wirkung überwiegt aber", meint Neuenkirchen, der selbst ins kalte Wasser gestoßen wurde.
Er hatte Karaoke "strikt abgelehnt", bis er das erste Mal von einer Kursgruppe in ein japanisches Karaoke-Center gezerrt wurde. "Es hat mir dann aber großen Spaß gemacht."
Genau das ist Karaoke. Nur wer sich aus der Komfortzone heraustraut und sich auf die Bühne stellt, kann nachvollziehen, wie perfekt sich das Unperfekte anfühlen kann. Auch Matthias, der singende Informatiker, erinnert sich noch ganz genau an seinen ersten Karaoke-Auftritt, damals auf der Firmenweihnachtsfeier. "Es hat sich angefühlt wie eine Mutprobe."
Inzwischen kommt er mindestens einmal in der Woche zum Singen.