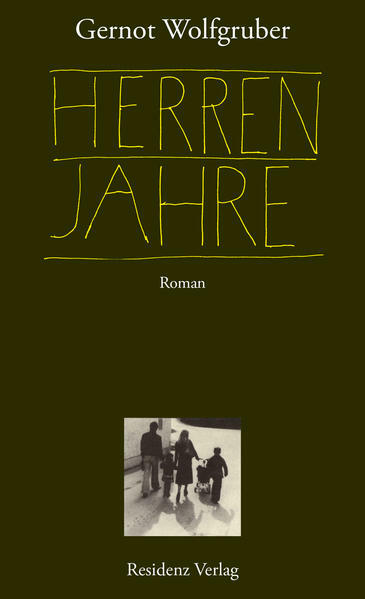Proletenpassion ohne Aussicht auf Erlösung
Klaus Nüchtern in FALTER 35/2015 vom 26.08.2015 (S. 31)
Der trostloseste Roman der österreichischen Nachkriegsliteratur, neu aufgelegt: Gernot Wolfgrubers „Herrenjahre“
Es ist erstaunlich, wie lange 40 Jahre zurückliegen können. Franz Innerhofers „Schöne Tage“ (1974), Gernot Wolfgrubers „Auf freiem Fuß“ (1975) und Thomas Bernhards „Der Keller“ (1976) lesen sich heute wie Berichte aus einer längst versunkenen Epoche. Alle drei Werke haben das Aufeinanderprallen von Adoleszenz und Arbeitswelt zum Thema, und ihre Lektüre sei allen jenen ans Herz gelegt, die in ihrer Kritik am Selbstdisziplinierungsregime des Neoliberalismus meinen, früher sei es irgendwie besser, weil durchschaubarer gewesen.
1976 legte Wolfgruber seinen Roman „Herrenjahre“ nach. Dergleichen lief seinerzeit unter „Literatur der Arbeitswelt“ und wurde unter der fragwürdigen Formel „Negative Heimatliteratur“ zu einem Exportartikel, der Österreichs Ruf als Epizentrum des Miserabilismus festigte, noch lange bevor dieser durch die Feel-bad-Movies von Haneke, Seidl & Co endgültig einzementiert wurde.
Die „Herrenjahre“ sind Hardcore – allerdings abseits jeglichen nihilistischen verzweiflungsfrohen Schicks. Im Vergleich zu ihnen nimmt sich Thomas Bernhard aus wie christliche Erbauungsliteratur. Bei Wolfgruber ist nicht nur jegliche Transzendenz nachhaltig ausgetrieben, sondern auch alle Aussicht auf innerweltliche Erlösung, sei diese nun privat-hedonistisch oder politisch gefasst: Der Germanist Wendelin Schmidt-Dengler hat denn auch darauf hingewiesen, dass Wolfgrubers Werk in diametralem Gegensatz zum „Gewerkschaftsoptimismus“ des jungen Michael Scharang steht.
„Herrenjahre“ lässt an „Lehrjahre“ denken, an Goethes „Wilhelm Meister“. Die Bezugnahme auf das Konzept des Entwicklungsromans ist sogar doppelt codiert: Wolfgrubers Protagonist teilt seinen Nachnamen nämlich auch noch mit dem Titelhelden aus Heimito von Doderers Roman „Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre“ (1951). Im Unterschied zu Doderers vornamenlosem Major, der über die Entwicklung seines Zivilverstandes zu wahrer „Menschwerdung“ findet, kann Bruno Melzer aber alle Hoffnung fahren lassen: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist einmal so. Immer so gewesen. Da kann man eben nichts machen. Später. Dauernd ist er auf später vertröstet worden. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das war keine Frage. Das sah er schon. Aber wann kamen die?“
Natürlich nie. Statt der Herrenjahre gibt’s nur den Herrenabend: jene rituellen Freitagabendzusammenkünfte, bei denen die Weiber nichts zu suchen haben und sich die Herren ungestört ansaufen und sentimentalen Erinnerungen an ihre „wilden Zeiten“ nachhängen können.
Der Eindruck von Authentizität, der sich bei der Lektüre einstellt, verdankt sich zum einen der ungeschönten, Kolloquialismen, Dialekt und Obszönitäten ungeniert wiedergebenden Sprache, zum anderen der strikt auf den Protagonisten beschränkten Erzählperspektive, die kein sinnstiftendes Narrativ kennt.
Konsequent konsekutiv wie sonst nur bei Marlene Streeruwitz wird der zähe Ablauf alltäglicher Verrichtungen und der sie begleitenden Gedanken, Empfindungen und Fantasien verzeichnet. Der einzige Perspektivwechsel, der stattfindet, richtet sich bezeichnenderweise gegen den Protagonisten. Es ist gleichsam das Über-Wir des Kleinstadtkollektivs, das hier zu Wort kommt: „Was glaubte Melzer eigentlich? Glaubt er vielleicht, daß er ein Recht hat, ein paar Minuten am Tag ein wenig glücklich zu sein?“
Dem Streben nach Glück, das die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung als unveräußerliches Recht des Individuums definiert, wäre Bruno Melzer schon verpflichtet, bloß dass die Mittel dafür dürftig sind. „Es gab nichts, was ihm so als das ganz andere des Alltäglichen vorkam, als wenn er mit Mädchen zusammen war. Das schien ihn richtig herauszureißen aus dem Gewöhnlichen.“
Bezeichnenderweise findet sich diese Passage bereits auf Seite 14 des Romans, denn die Begeisterung fürs andere Geschlecht weicht bald einem zynisch-routinierten Futkarlitum, das Melzer auch nicht aus dem Ehe- und Familienalltag herauszureißen vermag, in den er absichts- und ansatzlos gerät, als eine seiner Eroberungen schwanger wird. Der Umstand, dass Maria die Ziehtochter einer Fabriksbesitzerin ist, nutzt auch nichts, da diese in ihrer Empörung über die standesungemäße Liaison nicht daran denkt, eine Mitgift herauszurücken.
Ehe er sich’s versieht, hat Melzer eine Frau und ein, zwei, drei Kinder am Hals. Der Auszug aus der Wohnung der Mutter, die ihren Ältesten, Frucht eines Fronturlaubs des lieblosen Vaters, zugleich gluckenhaft umsorgt und kontrolliert, setzt lediglich einen Kreislauf von Verpflichtungen in Gang, der schließlich zum unvermeidlichen Hausbau führt.
Dem ebenso unleidlichen wie selbstmitleidigen Protagonisten ist eine einzige Szene gegönnt, in der er so etwas wie Mitgefühl und Menschenfreundlichkeit zeigen darf. Konsequenterweise mutet sie halb kitschig, halb surreal an. Am Klo in der neuen Bude findet Melzer einen wintersteifen Schmetterling, den er für seine Kinder in einer leere Schraubenschachtel packt. Prompt wird er bei der Taschenkontrolle, die an der Stechuhr per Zufallsprinzip verfügt wird, des Schraubendiebstahls bezichtigt, ehe die Schachtel dem Betriebsleiter doch verdächtig leicht vorkommt: „Da ist gar nichts drin, sagt er verwundert, und er macht die Schachtel auf. Nicht, schreit Melzer, aber da fliegt der Schmetterling schon heraus, steigt steil in die Höhe und stürzt hinter dem Zaun irgendwo in den Schnee.“