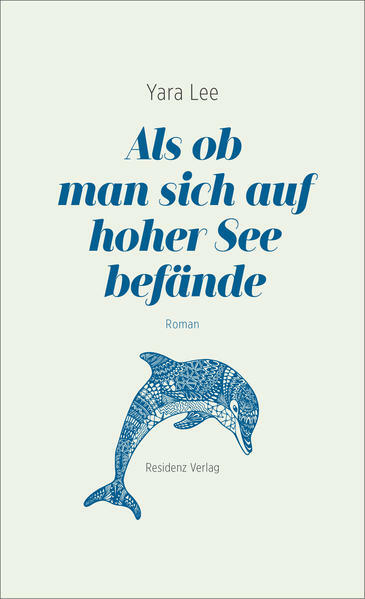Treffen sich zwei oder: Yara Lees andere Erzählung von Liebe
Sebastian Fasthuber in FALTER 28/2018 vom 11.07.2018 (S. 29)
Die Kunsthistorikerin Marla und der Delfinforscher James laufen einander zufällig am Bahnhof über den Weg. Es regnet, er ist mit einem Schirm zur Hand, begleitet sie zur U-Bahn und kritzelt schnell seine Telefonnummer auf die Rückseite ihres Fahrscheins. Sie ruft ihn kurz darauf an, man landet im Bett und flugs in einer Beziehung, die intensiv ist, aber bald wieder zerbricht. Zu unterschiedlich sind der pragmatische, karriereorientierte James und Marla, die sich ständig in Gedanken und Gefühlen verliert. Ende.
Die Kürzest-Nacherzählung lässt Bilder von x-beliebigen, oft im Halbschlaf wahrgenommenen Fernsehfilmen entstehen. Sie wird dem Reiz dieses Romans allerdings so gar nicht gerecht. Denn der Erstlingsroman der in Wien lebenden Yara Lee ist eines dieser rar gewordenen Bücher, in denen es nicht in erster Linie darum geht, was erzählt wird, sondern wie: den Rhythmus, das Tempo und den Ton der Sprache.
„Als ob man sich auf hoher See befände“ ist nicht einmal 200 Seiten lang, die einzelnen Kapitel sind nur zwei bis vier Seiten kurz. Dennoch verlangt einem das Buch einiges an Konzentration und Zeit ab. Wer nur erfahren will, wie es mit James und Marla weitergeht, wird nicht viel davon haben. Die Hauptsachen sind hier oft die scheinbaren Nebensachen.
Anstatt die Erzählung voranzutreiben, setzt Lee ihre Protagonistin schon nach ein paar Seiten in eine Kirche, wo ihr eine Frau ungefragt ihre Lebensgeschichte erzählt. Sie lässt Marla sich beim Verfassen einer kunsthistorischen Arbeit in Assoziationen verlieren. Und ihr Roman vermittelt eine ganze Menge an Wissen über Delfine. Er enthält eine Reihe solcher kleiner Abschweifungen, die aber wohldosiert sind.
Der Titel „Als ob man sich auf hoher See befände“ wiederum erlaubt sich ein wenig Pathos. Von hier ist es nicht mehr weit zu „Denn kein Meer ist so wild wie die Liebe“, dem zitternden Höhepunkt von „Merci, Chérie“. Lees Roman lebt von der Musikalität der Prosa, bleibt aber, anders als Udo Jürgens, meist zurückhaltend. Bei ihr geht es um Zwischentöne. Nicht zufällig ist die Autorin auch Pianistin. In Deutschland geboren und aufgewachsen, hat sie dort sowie in Belgien klassisches Klavier studiert. Nach dem Abschluss kam sie nach Wien und schrieb sich am Institut für Sprachkunst an der Angewandten ein. Unter ihrem bürgerlichen Namen Afamia Al-Daya tritt sie nach wie vor als Musikerin auf, Lee ist der Mädchenname ihrer Mutter.
In einem zweiten Erzählstrang sucht ein langsam alt werdender Mann namens Ulysses seine Tochter. Nach dem Tod seiner Frau hat er Marla Nonnen zur Erziehung übergeben und sie seither nicht mehr zu Gesicht bekommen. Am Ende wird er sie wiedersehen, in einer berührenden kleinen Szene, die ohne Gefühlsfeuerwerk auskommt. Das leise Happy End eines Romans, dessen Figuren keine große Neigung zum Glück haben.