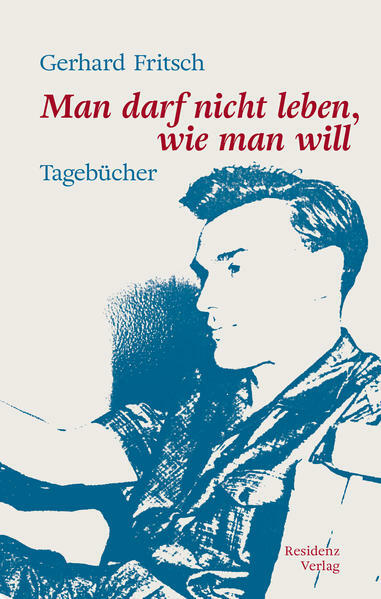Im Innenkino eines Cross-Dressers
Sebastian Gilli in FALTER 12/2019 vom 20.03.2019 (S. 10)
Die Tagebücher von Gerhard Fritsch enthüllen das Leiden am Provinzialismus der Nachkriegszeit
Er gilt als einer der einflussreichsten und ist gleichzeitig einer der unbekanntesten Autoren des Landes nach 1945: Gerhard Fritsch (1924–1969). Die heimische Literaturgeschichte der 1950er- und 1960er-Jahre ist ohne ihn nicht zu denken, sein aufklärerisches Denken, seine Kritik am spießbürgerlichen und provinzlerischen Österreich der Nachkriegszeit stellen ihn in eine Reihe mit Thomas Bernhard, Hans Lebert oder Elfriede Jelinek. Am bekanntesten ist noch sein Hauptwerk „Fasching“ (1967) um den in Frauenkleider gesteckten Deserteur Felix Golub, der 2015 am Wiener Volkstheater in einer dramatisierten Fassung zu sehen war.
Jetzt wurden Fritschs Tagebücher veröffentlicht. Obwohl die Aufzeichnungen den Zeitraum zwischen dem 13. Juni 1956 und dem 21. Juni 1964, also ziemlich genau acht Jahre umfassen, beträgt der Umfang lediglich 140 gedruckte Seiten.
Als Herausgeber fungierte der Germanist und Leiter des Grazer Literaturhauses Klaus Kastberger, sein Fachkollege, der Fritsch-Fachmann Stefan Alker-Windbichler, hat Fritschs handgeschriebene Hefte, die sich als Teil des Nachlasses in der Wienbibliothek im Rathaus befinden, sorgfältig transkribiert und mit einem akribischen, mehr als 100 Seiten langen Kommentar versehen.
Wie notwendig das ist, zeigt sich schon nach kurzer Lektüre: Der umtriebige Netzwerker Fritsch, eine zentrale Figur im zeitgenössischen Literaturbetrieb, führt Unmengen an Namen, Vornamen, Spitznamen, Abkürzungen an, der beschäftigte und dankbare Leser blättert eifrig vor und zurück.
Fritsch war ein rastloser, hellhöriger und wandlungsfähiger Autor, aber kein gewissenhafter Chronist, der für die Nachwelt schrieb. Er mühte sich eher ab und unternimmt immer wieder neu Anlauf. Die Tagebücher, die aus gutem Grund den Titel „Man darf nicht leben, wie man will“ tragen, sind dezidiert als intimes Bekenntnis zu verstehen.
Der Bezug zum eigenen Werk wird offenkundig: Privat und beim Schreiben trug Fritsch als „heterosexueller Cross-Dresser“ (Kastberger) selbst Frauenkleider, eine Neigung, die er in der Öffentlichkeit nicht ausleben konnte. Nur seine zweite Frau Annemarie war eingeweiht, gemeinsam gingen sie einkaufen: „das Kleid um 1300,– vom Graben!“
Die Tagebucheinträge begleiten die Schilderung privater Ereignisse mit Reflexionen der eigenen inneren Zerrissenheit, und Fritsch erweist sich als „Kommentator des Innenkinos“, der darum kämpft, dem Transvestitismus in der Literatur eine Stimme zu verleihen. Die Rede ist von „Geheimschriften“, die er mit „Helmut-Story“ oder „TV-Story“ (TV steht für Transvestitismus) bezeichnet, die im Nachlass aber nicht überliefert sind.
Der Umstand, dass man Fritsch am 22. März 1969 erhängt in Frauenkleidern findet, hat lange die These vom Suizid gestützt. Der Schriftsteller könnte allerdings auch, wie der Herausgeber mutmaßt, bei einem seiner offenbar regelmäßig praktizierten „autoerotischen Würgerituale“ verunfallt sein.
Fast genau 45 Jahre davor, am 28. März 1924, wurde Fritsch in Wien als Sohn nordböhmischer Eltern geboren (der Vater war Mittelschullehrer). Während des Zweiten Weltkriegs hatte Fritsch als Funker bei der Luftwaffe gedient, war kurz in Kriegsgefangenschaft und begann sein Studium der Germanistik und Geschichte an der Universität Wien.
Anfang der 50er-Jahre beginnt Fritsch seine Arbeit als Bibliothekar, ehe er sich 1959 für das Dasein als freier Schriftsteller entscheidet. Als Lyriker und später mit seinem Roman „Moos auf den Steinen“ (1956) erntet er erste Erfolge, mit „Fasching“ erfolgt eine Umorientierung: Fritsch bricht mit der Tradition, die in die Donaumonarchie zurückführt und vollzieht den Wandel zur Avantgarde und zur Anti-Heimatliteratur.
In dieser Zeit ist er auch als Rezensent, Lektor und Herausgeber von Literaturzeitschriften tätig und sitzt in zahlreichen Jurys. Der Vielschreiber Fritsch, der sich gerne in Vorstadtkaffeehäusern aufhielt, war dreimal verheiratet und hatte vier Kinder.
Die Tagebücher geben Auskunft über die familiären Verpflichtungen, aber auch über Fritschs politische Reflexionen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Der Ungarnaufstand 1956 wühlt ihn besonders auf, und während er sich an der Hilfe für ungarische Flüchtlinge beteiligt, wird sein Hass auf den Kommunismus immer größer: „Nieder mit den Ideologien!“ Vier Jahre davor war Fritsch noch überzeugter Sozialist gewesen und aus pragmatischen Gründen der SPÖ beigetreten: „weil ich eine Wohnung will.“ Später liebäugelte er mit dem Katholizismus.
1959 ist ein Wendejahr in Fritschs Leben: Er wird freier Schriftsteller und verabschiedet sich von dem, was er seine „vegetative“ Lebensweise nennt. Er heiratet seine dritte Frau Bärbel Eichhausen, mit der er viel in der heimischen Provinz unterwegs ist. Ein Kurzurlaub führt die beiden im September 1963 ins steirisch-burgenländische Grenzland, von wo Fritsch seine desillusionierende Sicht auf Oberpullendorf festhält: „Trotz Suche elendes Quartier. Durch die Müdigkeit besonders gespenstische Impressionen eines Sonntagabends in hoffnungsloser Provinz. Betrunkene Burschen, ein eunuchoider Straßenkehrer, der Cafehausgast mit Elefantitis auch im Gesicht, ungarisch-kroatisch-deutsche Bauern, die Wirtin eine asiatische Matrone, Hundegebell, unorganische Fassaden und Mopedlärm bis in den Schlaf.“