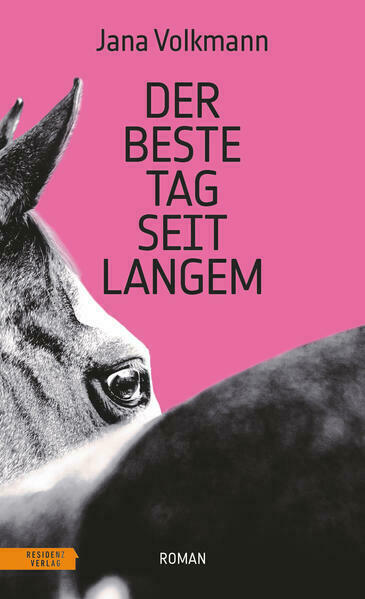Nutztiere des Landes, vereinigt euch!
Daniela Strigl in FALTER 42/2024 vom 16.10.2024 (S. 14)
Der Roman fängt geradezu klassisch an: „Cordelia sah das Pferd zuerst. Es stand an die Außenwand eines Gasthauses gelehnt, als hätte es gesoffen, und schaute leer in die von einer Unzahl Sternen perforierte Nacht.“ Wir befinden uns in der Mitte Wiens und des Sommers, ein Abenteuer bahnt sich an, doch was als individuelle Entdeckungsreise in die Gefilde tierischer Nachbarschaft beginnt, endet als offene Revolte gegen die menschengemachte Ordnung der Dinge.
Noch ahnt das niemand. Das Pferd, eine buchstäblich abgehalfterte Rappstute, folgt der Icherzählerin und ihrer Nichte Cordelia quer durch die Stadt bis zu deren Haus und Garten am Rand, einem etwas desolaten Anwesen in bester Lage. Die Erschöpfung des Tieres sowie seine deutlichen Gebrauchsspuren legen die Vermutung nahe, es könnte sich um einen entlaufenen Fiakergaul handeln.
Die beiden Frauen taufen die neue Mitbewohnerin Isidora und fühlen sich überfordert, haben sie doch keine Ahnung von Pferdehaltung. Alle einschlägigen Bücher „taten in Kapitel 1 ihr Möglichstes, um gewöhnliche Menschen wie uns davon abzuhalten“. Doch vergeblich: „Wenn ich improvisieren musste, lief ich zur Hochform auf. […] Ich war dafür zuständig, dass uns niemals der Mut verließ, den es brauchte, um schlechte Ideen in die Tat umzusetzen. Und Cordelia setzte die schlechten Ideen in die Tat um.“
Die Lage erinnert an die Villa Kunterbunt und Pippi Langstrumpf, die ihr Pferd auf der Veranda hält, weil es in der Küche nur im Weg wäre. Isidoras Anwesenheit im Garten soll geheim gehalten werden, vor allem vor den einschüchternd tüchtigen Nachbarinnen, den Kargls, einem „Konglomerat aus Anwältinnen, drei Generationen mindestens“.
Doch dann entscheidet die Autorin sich offenkundig gegen das leicht skurrile Kinderbuchsetting und entwirft ein unbehagliches, verstörend gegenwärtiges Zukunftsszenario, wie sie das ähnlich schon in ihrem Debüt „Auwald“ (2020) getan hat.
Bald wird klar, dass Isidoras Arbeitsverweigerung kein Einzelfall ist: Überall quittieren Tiere den Dienst, Hennen flüchten aus Legebatterien, Laborhunde verstecken sich im Wald, Schweine stürmen durch die Simmeringer Hauptstraße. Sie finden Unterstützung durch immer mehr Menschen, die gesetzwidrig Käfigtüren öffnen und den Generalstreik der Nutztiere propagieren, bis eines Tages Blut fließt.
Während ihre Nichte sich den Aktivisten anschließt, bleibt die Erzählerin bei aller Sympathie skeptisch. Nicht zufällig verweist ihr Name – Maja Stirner – auf den Philosophen Max Stirner, der 1845 mit „Der Einzige und sein Eigentum“ die Urschrift eines Anarchismus der Individuen vorlegte. Maja, unkonventionell, aber träge, von einer tiefen Angst bestimmt, seit Jahrzehnten festgebannt in ihr Haus, als Interview-Lektorin auch beruflich eine Eigenbrötlerin – sie lässt sich von ihren tierischen Bekanntschaften und Cordelias Wagemut aus der Reserve locken, ohne wirklich mitzutun.
Nebenbei erzählt der Roman eine Familiengeschichte der Lücken und Ausfälle. Auch die Halbwaise Cordelia ist ihrer Tante zugelaufen wie eine Katze oder wie nun die Stute: „Für uns würde sie immer das sich selbst klauende Pferd bleiben: eine Davonstehlerin.“
Es ist eine weibliche Verschwörung, die der Welt der Nützlichkeit und Vernutzung den Kampf ansagt, aber Männer mischen mit, allen voran Micha „Gorbi“ Gorbach, der wackere Tierarzt, der auf den Spuren von Hugh Loftings Doktor Dolittle wandelt.
Aber anders als im Kinderbuchklassiker der Tierrechte versteht hier bis fast zum Schluss keiner die Sprache der Kreatur, und zwischen Tier und Tierfreundin bleibt stets ein Quantum Fremdheit, das im Biss seinen sinnfälligen Ausdruck findet. Der titelgebende „beste Tag seit langem“ ist gleichwohl einer der chaotischen Harmonie zwischen allen Beteiligten, vom Findelhund, einem angstgebeutelten Beagle, bis zur gar nicht so z’wideren Kargl-Nachbarin.
Auch wer in Fiakerpferden nicht den Inbegriff entfremdeter Arbeit sieht, kann von diesem Buch etwas lernen. Volkmanns betont distanzierte Erzählhaltung äußert sich in Humor und milder Ironie, ihre Sätze sind präzis und eröffnen doch einen Raum für das Anschauliche und Unerprobte, passagenweise riskieren sie höchste poetische Konzentration. Das rätselhafte Wiesenbild im Prolog bereitet Majas finalen Aufbruch in ein verheißungsvolles Niemandsland vor: ein Zug am Abstellgleis als Arche Noah. Jana Volkmann hat zum Glück einen Roman geschrieben und kein Manifest.