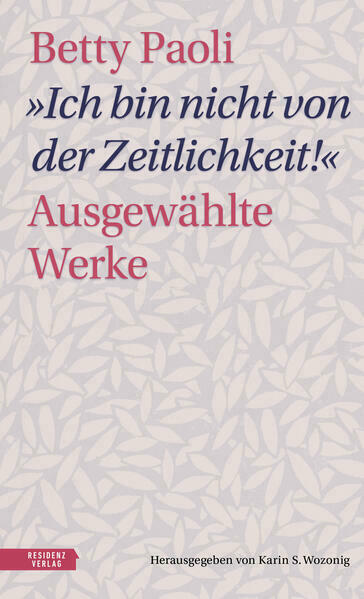„Imposant gescheit und hinreißend“
Julia Kospach in FALTER 12/2025 vom 19.03.2025 (S. 20)
Es gibt da ein Foto aus dem Jahr 1891. In leicht sepiagetöntem Schwarzweiß zeigt es einen überladenen Wiener Salon. Um einen Tisch sitzen drei alte Frauen mit Häubchen und hochgeschlossenen Kleidern beim konzentrierten Kartenspiel. Die Szenerie verströmt eine wunderliche Mischung aus Wohlgesittetheit, Selbstbewusstsein und Spielernst und hat etwas von einer gender-inversen Kartenrunde in einem Offiziersclub. Auf schwer greifbare Weise unterläuft sie Sehgewohnheiten und fasziniert einen umso stärker, je länger man sie betrachtet.
Es handelt sich um die Schriftstellerinnen Betty Paoli und Marie von Ebner-Eschenbach sowie um Paolis Freundin Ida Fleischl, in deren Familienverband sie fast 40 Jahre lang lebte. „Taröckchen“ – wie sie es untereinander nannten – spielten die drei über Jahrzehnte in eingeschworener Runde.
Betty Paoli? Nie gehört? Das Verblüffende an der Geschichte ist, dass die um knapp 16 Jahre jüngere Marie von Ebner-Eschenbach bis heute eine fixe Größe des österreichischen Literaturkanons ist, während die zu Lebzeiten legendäre Dichterin, Journalistin, Übersetzerin, Rezensentin und Feuilletonistin Betty Paoli (1814–1894) weitgehend in der Vergessenheit versunken ist.
Umso interessanter ist die 500 Seiten umfassende Biografie „Betty Paoli. Dichterin und Journalistin“, für die sich die auf Literatur des 19. Jahrhunderts spezialisierte Literaturwissenschaftlerin Karin S. Wozonig der Aufgabe unterzogen hat, aus unzähligen, weit verstreuten Quellen eine umfassende Darstellung von Leben und Werk dieser faszinierenden Frau zu verfassen, deren Wesen bereits Zeitgenossinnen noch „mehr geeignet schien, Romane zu erleben, als sie zu schreiben“.
Parallel zur Biografie hat Wozonig auch eine Werkauswahl unter dem Titel „Betty Paoli. Ich bin nicht von der Zeitlichkeit!“ herausgegeben, sodass man sich nun erstmals umfassend in Leben und Werk Paolis einlesen kann.
Und was für ein Leben das war! Gleichermaßen geprägt von den erstickenden Beschränkungen, die das 19. Jahrhundert weiblicher Lebensführung aufzwang, wie vom Ehrgeiz, diese zu durchbrechen – auch im Literarischen. Sicher ist, dass ein Vers Paolis, den Wozonig ihrer Biografie als Motto voranstellt, Gültigkeit für sie hatte: „Was ich bedurfte, mußt’ ich selbst erringen.“
Geboren in Wien als Tochter eines früh verstorbenen Militärarztes (vielleicht auch als leibliche Tochter eines Fürsten Esterházy) und einer wenig stabilen Mutter, sorgte Betty schon als 16-Jährige als Gouvernante fürs Familieneinkommen. Extrem wissbegierig, widmete sie einen Großteil der ihr verbleibenden Zeit dem Fremdsprachenerwerb, der Lektüre und Korrespondenz – sowie dem Verfassen von Gedichten, wobei sie sich auch Metrik und Rhetorik im Selbststudium aneignete.
Mit Mitte 20 war Paoli, die früh in Almanachen und Literaturzeitschriften zu veröffentlichen begann, bereits eine gerühmte Lyrikerin, deren Verse auch vielfach vertont wurden. Sie war, wie ihre Biografin schreibt, die erste österreichische Dichterin, die eine weibliche Perspektive in die Literatur der Zeit einbrachte und in ihren Gedichten das lyrische Ich aus dem Kreis herausführte, „in dem sich eine Frau idealiter zu bewegen hat“. Das war neu und fiel ebenso auf wie die dichterische Hochbegabung Paolis, deren Lyrik ein Zeitgenosse als „geistreich und trostlos“ bezeichnete.
Bald schon steht Betty Paoli in Kontakt und Austausch mit den Großen ihrer Zeit – von Nikolaus Lenau über Adalbert Stifter bis zu Franz Grillparzer. Sie lebt als Gesellschafterin in jüdisch-großbürgerlichen und aristokratischen Häusern, mal mit mehr, mal mit weniger Glück, durch ihre Anstellungen und Dienstherrinnen an die unterschiedlichsten Wohnorte und Reisedestinationen gespült. Zugleich steht sie bald auch als glänzende und vielumworbene Person im Zentrum literarisch-künstlerischer Salons. Im Revolutionsjahr 1848, das die Pressefreiheit bringt und dessen herbeigesehnte Umwälzungen Paoli bald skeptisch beurteilen sollte, gelingt es ihr, als Frau im Journalismus Fuß zu fassen.
Und auch auf diesem Gebiet zählt sie zu den Pionierinnen, und ihre Reisefeuilletons, ihre Rezensionen und Kritiken, in denen sie mitunter „ihr Beil sausend und vernichtend“ herabfallen lässt, sind Tagesgespräch in der Kunst- und Kulturszene. Sie beschäftigt sich mit männlichen und weiblichen Rollenbildern. Mädchen- und Frauenbildung ist ihr zeitlebens ein wesentliches Anliegen.
Mit ihrer turbulenten Lebensführung, zu der auch ein früh verstorbenes uneheliches Kind gehörte, ihrem Arbeits- und Lerneifer und ihren regen geschäftlichen Aktivitäten passte die unverheiratete Paoli so wenig zum herrschenden Frauenbild ihrer Zeit wie mit ihren selbstbewussten Gedichten.
Wie sehr das die Gerüchteküche zum Brodeln brachte, ist ebenfalls Thema in Wozonigs Biografie. Eine Fürstin wie die aufgeschlossene Maria Anna Schwarzenberg, deren Gesellschafterin Betty Paoli fünf Jahre lang war, konnte es sich allerdings erlauben, „eine freimütige Lyrikerin an ihrer Seite zu haben, deren Herkunft rätselhaft und deren Vorleben mysteriös war“. Und die beim Schreiben einer ebenso heftigen und laut Selbstauskunft „unglücklichen Rauchpassion“ für Zigarren frönte. Erst deutlich später, im Wiener Haushalt des Ehepaares Fleischl-Marxow, in dem Paoli ab 1855 lebte, kam sie zu etwas Ruhe und wurde unter anderem zur Förderin der jüngeren Marie von Ebner-Eschenbach – und zur Partnerin bei den eingangs erwähnten Tarockpartien. Ebner-Eschenbach notierte einmal in ihrem Tagebuch über Paoli: „Eine Minerva, eine Olympierin. Imposant gescheit und hinreißend, wenn sie sich herablässt liebenswürdig zu sein.“
In dieser Rezension ebenfalls besprochen: