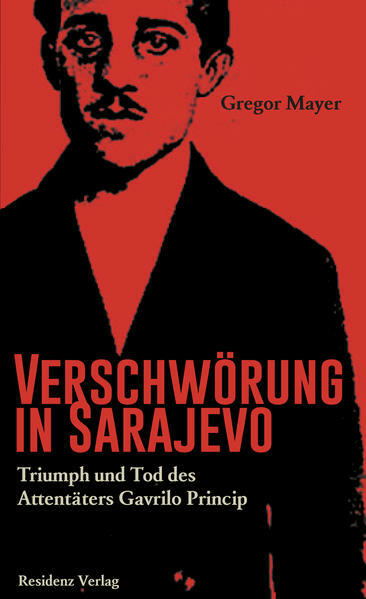Im Humus der Manipulation: das Leben Gavrilo Princips
Norbert Mappes-Niediek in FALTER 9/2014 vom 26.02.2014 (S. 18)
Der Journalist Gregor Mayer liefert mit seiner Biografie des Thronfolger-Mörders ein lesenswertes Buch zum Gedenkjahr 2014
Über den Ersten Weltkrieg kann man kluge, dicke Bücher schreiben und dabei den Streit, der ihn ausgelöst hat, fast ganz beiseitelassen. So haben Historiker sich auch in 100 Jahren nicht darauf einigen können, ob das Attentat von Sarajevo nun eine heroische Befreiungstat oder ein feiger Mord war. Manche entledigen sich der Frage, indem sie den Täter, den 19-jährigen Gavrilo Princip, für "verwirrt" oder zum "Opfer" erklären.
Gregor Mayer aber ist Agenturjournalist und also gewöhnt, seine Themen auf den Punkt zu bringen. Er stellt Princip und seine jugendlichen Mitverschwörer in den Mittelpunkt und entfaltet aus ihren Biografien die Vor- und die Nachgeschichte des Krieges. Das Verfahren hat sich bewährt: Der historisch Interessierte erhält mit dem schmalen, klugen, analytisch scharfen Büchlein mehr Aufklärung als durch so manchen dicken Wälzer.
Gavrilo Princip, der am 28. Juni 1914 den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand erschoss, gehörte zu einem Kreis "hochpolitischer junger Leute", wie Mayer mit den wenigen Zeitzeugnissen nachweist. Als Princip, zu lebenslanger Haft verurteilt, in der Festung Theresienstadt saß und dort an Knochentuberkulose langsam zugrunde ging, gehörte zu den wenigen, die ihn besuchen durften, ein gewisser Martin Pappenheim. Der linke Psychiater aus Wien traf auf einen sensiblen jungen Mann, der die Widersprüche seiner Epoche sichtbar machte, und das war durchaus kein Zufall. Der Kult der Tat gegen die langweilige Schlaumeierei der Epoche, der Affekt gegen Fremdbestimmung und Kolonialismus, die sozialen Gegensätze – all das hatte der Gymnasiast sich angelesen.
Mayer wertet Pappenheims Gesprächsprotokolle aus und verfolgt dann mit Neugier und Erzählfreude den Lebensweg des – später übrigens höchst umstrittenen – Psychiaters bis zu dessen Tod, 1943, in Tel Aviv. Auch dieses Verfahren bewährt sich, denn die scheinbar zufälligen Bezüge zwischen dem Attentat und Ereignissen, die weit in das 20. Jahrhundert reichen, ermöglichen immer wieder überraschende Rückblicke auf das Geschehen des Jahres 1914.
Manische Fixierung auf Serbien
In den folgenden Kapiteln weitet der Autor den Blick auf das Städtedreieck Wien – Belgrad – Sarajevo. Die ehrwürdige Monarchie sumpfte in ihrer viel beschriebenen Selbstgewissheit bräsig vor sich hin und gab ihren Stillstand als Standfestigkeit gegenüber äußeren Störenfrieden aus. Aus Sätzen wie jenen des Außenministers Alois Lexa von Aerenthal, der "dem serbischen Lausbuben eine Lektion erteilen" wollte, und seines Sektionschefs, der das "serbische Geschwür" gern "ausgequetscht" hätte, liest Mayer eine "manische Fixierung auf Serbien". Nur ein äußerer Feind konnte schuld sein an dem aufkommenden Nationalbewusstsein und der Rebellion, die immer mehr Untertanen des Kaisers erfassten. Gegen Habsburg-Nostalgie, wie sie manchen Historiker in diesen Tagen befällt, ist Mayer als Österreicher immun. Als langjähriger Balkankorrespondent widersteht er aber auch der Versuchung, das Reich des Lichts nun in Serbien zu suchen.
Eine Reportagereise zu den Cafés und Treffpunkten der Verschwörer in Belgrad führt den Leser in eine Szene, in der es immer noch eine Wahrheit hinter der Wahrheit gibt und niemand recht weiß, wem die Loyalität des je anderen am Ende gehört: in den Humus der Manipulation also, der auch nach 100 Jahren eine reiche politische Vegetation hervorbringt.
Auf den Spuren des jungen Bosnien
Unklar ist zum Beispiel noch immer, ob Princip und seine Freunde am Ende auf eigene Rechnung handelten oder doch im Auftrag der geheimen Gesellschaft "Vereinigung oder Tod" mit dem intriganten Belgrader Offizier Dragutin Dimitrijević an der Spitze. Im letzten Moment hatte dieser das Attentat, das er vorbereiten half, abgeblasen, ein Bote hätte den Verschwörern in Sarajevo den Beschluss mitteilen sollen. Ob der Bote dann aber doch – womöglich im Auftrag Dimitrijevićs – grünes Licht gab, wird immer unklar bleiben. "Die serbische Regierung", schreibt Mayer, "die das Attentat nicht aufzuhalten vermochte, war schließlich an maximaler Vertuschung interessiert, als das Malheur nun schon einmal in der Welt war."
Das Epizentrum des Konflikts aber war Sarajevo, die Hauptstadt Bosniens. Wer heute durch die Stadt streift, entdeckt überall die glanzvollen Zeugnisse der habsburgischen Epoche, die 1878 begann, imposante Bürogebäude in Schönbrunner Gelb, aber mit orientalisch anmutenden Tudor-Bögen, und überall kann man sich den Lobpreis der weisen Herrschaft Wiens abholen.
Aber das Junge Bosnien, dem Princip und seine Freunde sich zugehörig fühlten, war eine Bewegung eben gegen die Fremdherrschaft und vor allem deren "pedantischen Geist", den Mayer uns mit den Worten des Literaturnobelpreisträgers Ivo Andrić vergegenwärtigt. Auch mit dem Fortschritt war es nicht weit her, auch wenn man das heute in Sarajevo glauben machen will. Im dem Land mit seinen zwei Millionen Einwohnern gab es ganze drei, am Ende sechs Gymnasien und keine Universität. Die serbische Landbevölkerung musste sich nach wie vor von den kleinen Landbesitzern auspressen lassen, den Begs, mit denen es sich die österreichischen Besatzer nicht verscherzen wollten.
Mayers Buch ist glänzend geschrieben, satt erzählt und sicher im Urteil. Dass der weite Bildungshorizont des Autors und sein gründliches Studium der Forschungsliteratur sich nie in den Vordergrund drängen, macht die Lektüre zum Vergnügen. Wer auf einfache Gut-Böse-Dichotomien aus ist, kommt nicht auf seine Kosten.
Ein guter Journalist kommt immer auf den Punkt, ein sehr guter macht zudem seinen eigenen Standpunkt sichtbar.