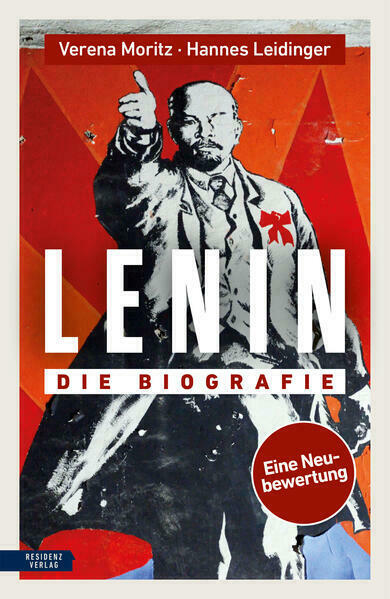Ein menschliches Antlitz gab es bei diesem Mann nie
Andreas Sator in FALTER 47/2023 vom 22.11.2023 (S. 19)
Wir alle fragen uns bei Menschen manchmal, wie sie so wurden, wie sie sind. Einige sind so wichtig, dass Historiker über diese Frage 650 Seiten dicke Bücher schreiben. Wladimir Iljitsch Uljanow -besser bekannt unter seinem Pseudonym Lenin -ist 17, als sein älterer Bruder wegen eines geplanten Anschlags auf den Zaren Alexander III. hingerichtet wird.
Der junge, zornige Lenin sucht nach Halt und Orientierung und findet ihn im Marxismus. Das "Kommunistische Manifest" war für ihn Glaubensbekenntnis, schreiben die Historiker Verena Moritz und Hannes Leidinger in ihrer neuen Biografie des Begründers der Sowjetunion. Die beiden sind ausgewiesene Experten für die frühe Geschichte der Sowjetunion und unterrichten unter anderem an den Universitäten Wien und Salzburg und am Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung. Für diese Biografie haben sie noch einmal Einsicht in Originaldokumente genommen.
Schon mit 16 schwor Lenin seinem orthodoxen Glauben ab und fand im Marxismus eine Ersatzreligion. Dabei schrieb Friedrich Engels, Co-Autor des Manifests, man solle seine und Marx' Schriften nicht quasibiblisch als unumstößliche Weisheiten interpretieren, konstatieren Moritz und Leidinger. Sie geben dem Leser Kontext, ordnen ein und machen Lenins Leben und Wirken so auch für Leute zugänglich, die sich noch nicht mit ihm beschäftigt haben.
Nach seiner Verbannung nach Sibirien und vielen Jahren im Exil wird aus dem Gläubigen nach seiner Rückkehr ein Vollstrecker. Mit einer Handvoll Revolutionäre hebt er Russland aus den Angeln und prägt damit das 20. Jahrhundert in Europa und auf der ganzen Welt.
Über religiöse Gefühle lässt sich schwer diskutieren, Lenin wird im Buch als kompromissloser Ideologe, Besessener und Überzeugungstäter beschrieben. Nachdem er von der Universität in Kasan geworfen wird, ist er viel in der Natur und liest. Für die Landbevölkerung interessiert er sich kaum. Während Lenin sich theoretisch mit der Revolution beschäftigt, ist seine Schwester erstaunt darüber, wie wenig Mitgefühl er für Notleidende hat.
Von Hilfsaktionen hält er nichts. Hungersnöte waren ihm wie Bürgerkriege und Terror willkommen, um die Revolution zu beschleunigen. Sozialdemokraten wie Victor Adler (1852-1918), Arzt, Journalist, Politiker und Gründer der österreichischen Arbeiterpartei, konzentrieren sich darauf, die Lage der Arbeiter in den Fabriken zu verbessern.
Für Lenin gibt es nur alles oder nichts. Obwohl das Zarenreich noch kaum kapitalistisch geprägt ist und erst fünf Prozent der Bevölkerung wirkliche Arbeiter sind, will Lenin die sozialistische Revolution auf Biegen und Brechen erzwingen. Einen genauen Plan für seinen Sozialismus hat der Theoretiker jedoch nicht, als er an die Macht kommt.
Gewalt sieht er "als formende Kraft". Ob es legitim sei, Gegner zu ermorden, ist für Lenin keine Frage. Zur Not müssen auch unliebsame Arbeiter daran glauben. An der Macht ist er nur kurz, 1922 erleidet er seinen ersten Schlaganfall, zwei Jahre später stirbt er.
Im letzten Kapitel der Biografie gehen das bewährte Autoren-Duo Moritz und Leidinger (2017 erschien von ihnen "1917 - Österreichische Stimmen zur Russischen Revolution") auf den staatlich orchestrierten Kult ein, der um ihn von seinem Nachfolger Stalin kreiert wurde.
Heute wird er von der offiziellen Geschichtsschreibung und in den Schulbüchern anders bewertet. Der Zar als Erzfeind Lenins brachte Stabilität, die Revolutionäre Chaos. Dass Lenin ethnische Republiken in der Sowjetunion zuließ, nannte Wladimir Putin 2017 "eine Zeitbombe für unsere Staatlichkeit".
Wer Russland heute verstehen möchte, kommt an seiner Geschichte und damit an Lenin nicht vorbei. Ein Blick in "Lenin. Die Biografie. Eine Neubewertung" ist dafür sehr zu empfehlen.