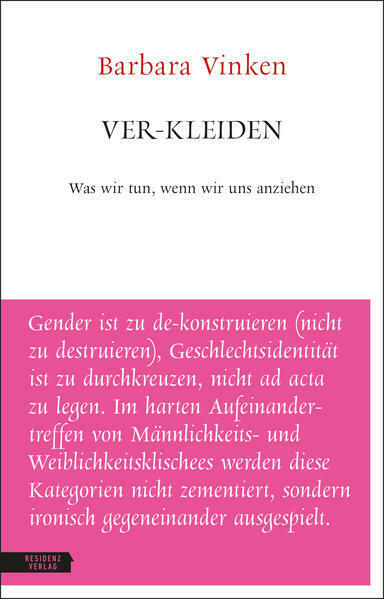Was heißt hier schon männlich?
Barbaba Tóth in FALTER 27/2023 vom 05.07.2023 (S. 20)
Echte Männer, echte Frauen -und alles, was dazwischen ist, brauchen wir nicht! Der Kulturkampf, den die FPÖ gegen alles, was sie als Queer, Trans, Woke oder irgendwas mit Gender definiert, beginnt gerade erst. Demonstrationen gegen Auftritte von Dragqueens oder das Verbot des Binnen-I im Amtsdeutsch sind lediglich die Vorwehen. Im Nationalratswahlkampf 2024 wird der Kulturkampf gegen alles, was die FPÖ als "abnormal" definiert, noch lauter werden.
Wer an einer kulturhistorischen Einordnung solcher Debatten interessiert ist, die ja nichts Neues sind, ist bei der deutschen Literaturwissenschaftlerin Barbara Vinken richtig. Der Band "VER-KLEI-DEN" basiert auf einer Vorlesung, die sie im Sommer 2022 an der Akademie Graz hielt. Vinken, Expertin für historische Modegeschichte, erzählt darin etwa, dass es vor der Französischen Revolution die Männer waren, die sich kleideten wie Pfaue. Sie galten als das "schöne" und "dekorative" Geschlecht. Sie zeigten ihre Beine in Strümpfen, schmückten ihren Schritt mit reichverzierten Schamkapseln. Aus heutiger Sicht sahen Männer damals aus wie maskuline Dragqueens.
Ebenfalls nicht gesetzt ist die zwar nicht mehr so dominante, aber immer noch starke Vorstellung, dass man Buben in Hellblau, Mädchen in Rosa kleidet. Sie ist überhaupt erst 100 Jahre alt. Bis in die 1920er-Jahre war das "kleine Rot", die Farbe der Buben. Zartes Blau galt als schicklich für Mädchen. Und etwas angestaubt wirken auch die gegenwärtigen Debatten über Geschlechtsumwandlungen, wenn man sich den Fall der US-Transfrau Caitlyn Jenner anschaut, die schon 2015 am Vogue-Cover war, inszeniert als "super-femininer Stereotyp".
Mit solchen Beispielen illustriert Vinken ihre Grundthese: Was wir beim Ankleiden, aber auch sonst, als "männlich" oder "weiblich" definieren, ist Konvention und Mode unterworfen. Geschlechtsumwandlungen sind nur die extremste Form dieser "neoliberalen Selbstoptimierung" des "Individuums als des Unternehmers seiner Selbst".
Bling-Bling auch in der Herrenmode
Nathalie Grossschädl in FALTER 42/2022 vom 19.10.2022 (S. 53)
Als der Schauspieler Brad Pitt diesen Sommer bei einer Filmpremiere in Berlin aufkreuzte, herrschte Aufregung: Der Endfünfziger zeigte sich in einem luftigen Rock, dessen Leinenstoff im Wind sanft seine nackten Waden umspielte. Der Auftritt des mittelalten, weißen Mannes im ungewohnten Kleidungsstück bot so gut wie allen Zeitungen Anlass für eine Schlagzeile.
Im September zog dann Timothée Chalamet, Schauspieler und Stilvorbild der jungen Generation Z, bei den Filmfestspielen in Venedig blank. Unaufgeregt, als wäre nichts, stapfte er im glänzenden, rückenfreien Overall über den Teppich. Kein ungewöhnliches Outfit für eine Frau – aber für einen Mann? Das Ereignis wurde Millionen Mal in den sozialen Netzwerken geteilt und hitzig diskutiert. Männer verführen nicht, sie werden verführt, scheint noch immer in den meisten Köpfen zu stecken.
Nun, der überpräsente Chalamet ist auch Oktober-Covermodel der britischen Vogue, um den Hals eine schimmernde Perlenkette, über Jahrhunderte ein Symbol für weibliche Eleganz. Auch dazu überschlugen sich die Meldungen: Ist der 26-Jährige doch der erste Mann, dem solo diese Ehre zugeteilt wurde – ein Novum in der 106 Jahre langen Historie der britischen Ausgabe der Modebibel.
Zugegeben, der rote Teppich und Magazincovers eignen sich besser als die normale Straße als Spielwiesen, um Geschlechternormen herauszufordern. „Aber wo sich hippe Menschen treffen – ob auf der Universität oder beim Ausgehen im Club – wird intensiv mit Geschlechterrollen gespielt“, sagt die Modetheoretikerin und Professorin für Literaturwissenschaft Barbara Vinken, die ihr neuestes Werk „Ver-kleiden“ diesem Thema widmet. Und Mode ist eben ein Seismograf für gesellschaftliche Strömungen.
Auf Nagellack für Männer und Springerstiefel für Frauen folgen nun Röcke, transparente Stoffe, reichlich Schmuck, wallende Rüschenhemden und tiefe Dekolletés für den Mann, beobachtet die Wissenschaftlerin. Im Kern reflektiert die Kleiderdebatte ein Thema, das einen Großteil der Modewelt und der Welt insgesamt gerade beschäftigt: die Geschlechterbinarität. Treffend schreibt Vinken: „Die Kämpfe um die Geschlechterdifferenz toben mit einer emotional aufgeladenen Intensität, wie sie nur noch Kriege oder Klimakatastrophen hervorrufen.“
Dabei sei Mode seit der Französischen Revolution in erster Linie Frauensache gewesen. Vor dem späten 18. Jahrhundert kleideten sich beide Geschlechter so gut es ging modisch. Erst mit dem Ende der Feudalgesellschaft wurde die mit Spitzenstoffen und Stickereien verzierte Kleidung der adeligen Männer abgeschafft. Nach der Revolution von 1789 trug der Mann Sakko. „Seither hatte der, der als Mann durchgehen wollte, auf aristokratische Zurschaustellung seiner körperlichen Reize zu verzichten.“ Denn der Herrenanzug erlaube nur geringfügige Variationen, und wenn ein Mann aus dem heutigen gewohnten Erscheinungsbild fällt, werde er schnell als „schwul“ bezeichnet, so die deutsche Modetheoretikerin.
Nun aber werden, modetechnisch gesprochen, alle Genderkorsetts gesprengt. „Be what you are“ lautet das verlockende Versprechen. Vinken sieht darin eine Umkehr der Einbahn, die seit Jahrzehnten von männlich zu weiblich laufe. Im Moment aber passiere in der Männermode weit mehr als in der Frauenmode.
Ein einflussreicher Wegbereiter dieser Strömung war etwa der französische Designer Hedi Slimane mit seinen schmalen Hosen und stark taillierten Jacken. Seine Silhouette stand ab den 1990er-Jahren für den modernen Mann. Man munkelte, einer seiner größten Fans, ein gewisser Karl Lagerfeld, habe extra 40 Kilogramm abgenommen, um sich in die Slim-Outfits hineinzuhungern.
Die Branche und die Laufstege sind längst offen für Genderfluidität. 2020 kündigte das British Fashion Council an, dass die Londoner Modewoche zu einer geschlechterübergreifenden Plattform übergehen und Damenkollektionen und Herrenmode in einer Show zusammenbringen werde. Und das italienische Modehaus Gucci führte 2020 in seinem Onlineshop „Gucci Mx“ ein: einen geschlechtsneutralen Einkaufsbereich mit einer Auswahl an genderfluider Kleidung, die von Models aller Geschlechter und Identitäten getragen wird.
Zurzeit bringen aus Vinkens Sicht Labels wie Gucci und der Designer John Galliano für Martin Margiela queere Mode und Crossdressing in ihren Kollektionen am klarsten zur Geltung. Alle Prinzipien weiblicher Mode fänden sich hier auf Mode für alle übertragen. Die Outfits seien anachronistisch tiefschichtig und nicht gradlinig modern, erotisch-sinnlich wie bis dahin nur die Kleider für das weibliche Geschlecht. Oft mit exquisiten Handarbeitstechniken, wie sie früher nur in Haute-Couture-Ateliers angewandt wurden, gefertigt.
Das schnörkellos Funktionale, das Ungeschmückte, die a-modische Männlichkeit werde nun verdrängt von der unbändigen Lust am Ver-kleiden, erklärt die 62-Jährige. Selbst das französische Modehaus Balenciaga, um das momentan am meisten Wind gemacht wird, komme im Zeichen des Crossdressings daher. Über dessen Konzept sagt Vinken: „Bestimmt wird die Kollektion von der Logik des Fetisch, die den Geschlechtsunterschied … im Dunkeln oder besser im unentscheidbaren, verführerischen Oszillieren lässt.“ Und der neue Trend sei weder Nische noch kurzlebiger Hype, sondern eine „langfristige Bewegung mit Tiefenstruktur“.
Und wie geht es nun der „Frauenmode“? Sie schöpfte ja einst aus dem Fundus traditioneller Männerkleidung. Queering war das Zauberwort, wie es bereits Anfang der 1910er-Jahre Coco Chanel mit dem Anzug oder dem Smoking vorführte.
In diesem Jahr war der ultrakurze Microminiskirt von Miu Miu außergewöhnlich erfolgreich und sofort ausverkauft. Von Vogue bis Vanity Fair tauchte er auf allen Covers auf, getragen von Frauen zwischen 18 und 60 Jahren. Nach wallenden Gewändern, Midi- und Maxi-Röcken und #MeToo feiere der Mini völlig hedonistisch ein triumphales Comeback, so Vinken. Sie liest darin die Geste eines Schulmädchens, das „sich selbst von aller Scham und allen Anständigkeitsregeln des Comme-il-faut“ rebellisch befreit. Der ausgefranste Rock, so groß wie eine „Po-Manschette“, kam in männlich konnotierten Stoffen daher, in grünem Armee- und grauem Anzugtuch. Kombiniert mit einem Schlabberpulli und darunter einem Herrenhemd, beide so kurz abgeschnitten, dass man die Unterseite des BHs sehen konnte.
Anscheinend führt die emanzipatorische Befreiung schlussendlich nicht direkt zur Genderneutralität, sondern zu mehr Sexiness. Und zwar für alle.