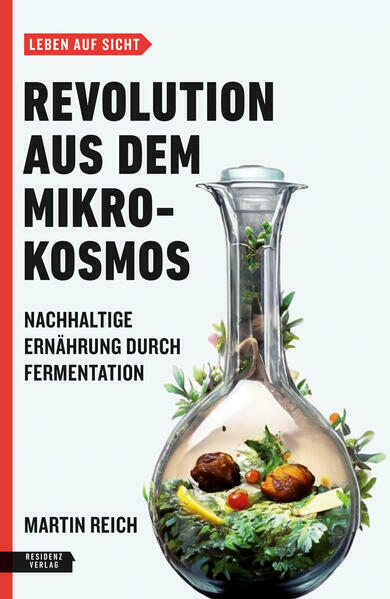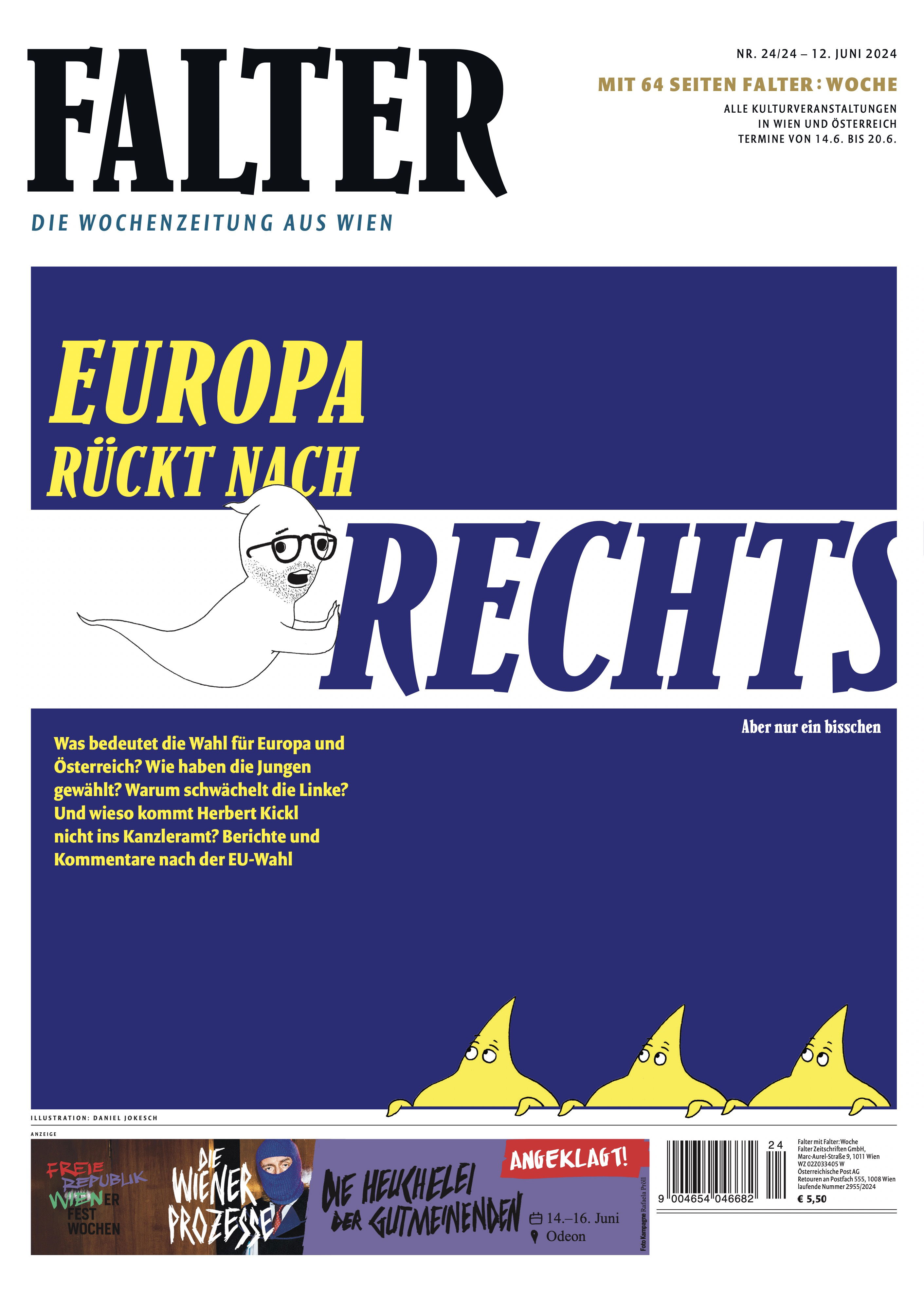
Kombucha for Future
Katharina Kropshofer in FALTER 24/2024 vom 12.06.2024 (S. 53)
In den sechs großen Glasbehältern am Fensterbrett schimmert eine trübe Flüssigkeit. Im Kühlschrank stehen Dutzende weitere Tiegel und Keramikbehälter, Gläser und Boxen bereit. Es mögen nur wenige Handgriffe für den Einzelnen sein. Aber das, was Martin Reich mit seiner Fermentation verbindet, ist eine große Hoffnung für die Ernährungssicherheit: Mikroorganismen, in diesem Fall Pilze und Bakterien, die Pflanzen und andere Rohstoffe zu Kombucha, Sauerteig oder Essig umwandeln.
Fachleute sprechen von Fermentation, wenn bei einer solchen mikroskopischen Umwandlung kein Sauerstoff im Spiel ist - bei Alkohol oder Sauerkraut zum Beispiel. Für Essig gilt das etwa nicht. Also hat sich an dieser Schnittstelle zwischen Forschung, Kulinarik und Industrie durchgesetzt, alles, was von Mikroorganismen hergestellt ist, als Fermentation zu bezeichnen.
Genau diese uralte Kulturtechnik ist in den Augen des Biologen Reich eine "Revolution aus dem Mikrokosmos", wie er es in seinem gleichnamigen Buch nennt. Und das ihn für eine Lesung auch nach Wien gebracht hat. Für seine Doktorarbeit an der Universität Groningen stellte er Pflanzen in Klimakammern. Bald tauschte er das Labor gegen seine Berliner Küche, Pipetten gegen Laptop und begann, für einen Fachverlag zu arbeiten.
Sein Hobby wurde wie bei vielen Leuten während der Corona-Lockdowns zu seiner Leidenschaft, von der er gerne und detailreich erzählt -wie unlängst im Café Korb im ersten Bezirk. "Ich finde Ernährung super, weil es ein so emotional besetztes Thema ist und gleichzeitig so viel Einfluss auf alles andere hat", sagt der Flexitarier.
Unser Ernährungssystem steht jedenfalls vor enormen Problemen: Fast die Hälfte der bewohnbaren Erdoberfläche nutzt der Mensch für Lebensmittelanbau und Weidehaltung, ein Drittel allein für die Produktion von Futterpflanzen. All das verbraucht Massen an Wasser, Dünger erzeugen wir aus fossilen Hilfsmitteln, und viele Abflüsse davon schädigen Ökosysteme. Ganze 20 Prozent der globalen Emissionen waren 2017 auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Und dann ist da noch die Notwendigkeit, einen Teil der Flächen für Windfarmen und Solaranlagen zu nutzen.
Dass sich der Großteil der Menschen aber zukünftig vegan ernährt, ist unrealistisch. Wieso die tierischen Produkte also nicht gleichwertig ersetzen? Man kann mit Fermentation schließlich Lebensmittel herstellen, die Fleisch, Käse, Milch und ihre Nährstoffe substituieren. Und das mit einer Technologie, die alles andere als neu ist.
Wenn Reich von den kleinen Lebewesen spricht, spannt er stets einen großen Bogen. Immerhin setzten Menschen schon vor mehr als 10.000 Jahren auf Fermentation. Im Jiahu-Gebiet des heutigen China oder im alten Ägypten erzeugten sie so alkoholhaltige Getränke. Lebensmittel wurden und werden durch Fermentation länger haltbar und vor allem nährstoffreicher.
Die Mikroorganismen leisten so etwas wie eine Vorverdauung: Zellulose oder Stärke sind komplex, heruntergebrochen können wir Vitamine und Mineralstoffe leichter nutzen. Die Kraft der Mikroorganismen dürfte uns also schon vor Jahrtausenden einen evolutionären Vorteil gebracht, unsere Gehirne leistungsfähiger gemacht haben - und unsere Körper toleranter gegenüber Alkohol. "Wir vertragen mehr als die allermeisten Tiere", sagt Reich und schmunzelt.
All das haben wir uns stets zum Vorteil gemacht. Und vor allem Krisen machen erfinderisch: Nach dem Ersten Weltkrieg bereitete man Brauereien in Deutschland darauf vor, auf Hefeproduktion umzustellen. Die eigene Landwirtschaft und der Import waren angeschlagen. Ein Überbleibsel sind die bei uns wenig beliebten Hefeaufstriche Marmite und Vegemite.
Und nun, in der aktuellen ökologischen Krise, sehen Expertinnen und Experten eine Umstellung unserer Ernährung als Notwendigkeit, um Klimaziele zu erreichen, Flächen für die Natur (und indirekt somit auch für uns) zu erhalten. Gleichzeitig steigt der Fleischhunger. Auftritt Fermentation: Ersetzt man bis 2050 etwa 20 Prozent des Fleisches durch mikrobielles Protein, könnten wir die Entwaldung halbieren, so eine Studie in der Fachzeitschrift Nature.
Fermentation ist aber nicht gleich Fermentation. Reich unterscheidet zwischen drei Methoden, um zu mikrobiellem Protein zu kommen: Erstens, Mikroorganismen direkt zu essen.
Am Geschmack müsste man noch schrauben. Option zwei: in riesigen Brautanks Mikroorganismen zu vermehren, zu ernten und daraus Lebensmittel oder Teile davon zu machen. Als Beispiel nennt er das Wiener Start-up Revo Foods: Sie "drucken" Mikroorganismen in Pulverform zu "Lachs".
Und dann ist da noch die Präzisionsfermentation. Diese spannt Mikroorganismen ein, um ganz bestimmte Stoffe und Lebensmittel herzustellen. Casein zum Beispiel, das mit Kalzium und pflanzlichen Fetten wiederum zu Käse wird. "Noch haben Leute viele Vorbehalte gegen solche ,zusammengebauten' Produkte. Aber das ist eher ein kulturelles Thema", sagt Reich. Anders als Käsealternativen auf Nuss-oder Sojabasis schmeckt der Bakterienkäse eher wie das Original. Er bestehe immerhin aus ähnlichen Inhaltsstoffen, das Fermentierte schmecke mehr "umami".
Noch ist es schwer, sich all das vorzustellen. Doch hat die Revolution erst begonnen, könnte sie noch viel waghalsigere Formen annehmen. Zumindest wenn man dem passionierten Fermentierer Martin Reich zuhört: "Man kann mit Präzisionsfermentation Häm, den Hauptbestandteil von Blut, herstellen. Und weil wir mittlerweile die genetischen Informationen von den meisten Tieren haben, könnten wir nicht nur Schweine-oder Rinderblut, sondern auch Tiger-oder Nashornblut herstellen." Er wäre sicher einer der Ersten, der das dann auch probieren würde.