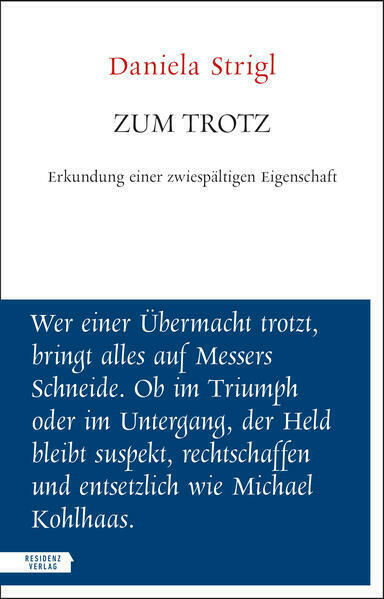"Ein Rebell ist trotzig, ein Revolutionär ist es nicht"
Stefanie Panzenböck in FALTER 32/2025 vom 06.08.2025 (S. 25)
Nein! Nein! Nein! Wer trotzig ist, ist mächtig. Aber natürlich auch nervig. Die Germanistin, Literaturkritikerin und Autorin Daniela Strigl befasst sich in ihrem neuen Buch "Zum Trotz" mit dieser Verhaltensweise, die keineswegs nur eine kindliche Phase ist -und die zu Unrecht oft negativ beurteilt wird.
Strigl gewinnt dem Trotz viele Facetten ab. Zum Beispiel seine ursprüngliche Bedeutung. Denn im Mittelalter bedeutete Trotzigsein vor allem, kühn und mutig zu sein, in die Offensive zu gehen. Anhand vieler Figuren erklärt sie die Darstellung des Trotzes in der Literaturgeschichte - die meisten dieser Trotzköpfe sind Männer. Warum durften Frauen nicht trotzig sein und warum waren es manche doch?
"Zum Trotz" ist ein kluges, anregendes, unterhaltsames und nicht zuletzt gut lesbares Buch, setzt es die Kenntnis der erwähnten Werke doch nie voraus.
Falter: Frau Strigl, warum sollten wir uns aktuell genauer mit dem Trotz beschäftigen? Damit wir Donald Trump besser verstehen? Daniela Strigl: Der US-Präsident ist auch in meinem Umfeld bei vielen die erste Assoziation zum Thema. Kaum wer denkt an Rebellen, die etwas Sinnvolles oder Gutes im Schilde führen.
Worin liegen diese positiven Qualitäten?
Strigl: Im Widerstand gegen die Obrigkeit. Der Begriff Trotz ist nach wie vor zwiespältig, aber in ihm steckt etwas Motivierendes, das nützlich sein kann, gerade auch in den Auseinandersetzungen um demokratische Werte.
Trotzig gegen den Trotz also, hieße das auf die USA gemünzt?
Strigl: Stolz, Widerstandskraft, Widerstandswille und Courage spielen beim Trotz eine Rolle. Aber auch Eigensinn, Sturheit und Selbstgerechtigkeit. Wenn man von einer Sache komplett überzeugt ist, kann das in Fanatismus enden. Zum Trotz gehören Scheuklappen, die Gefahr eines Tunnelblicks. Nicht jeder trotzige Mensch nimmt links und rechts nichts mehr wahr, aber die Gefahr ist groß, dass man sich verrennt. Oder man ist aus Prinzip dagegen und prüft die Argumente der Andersdenkenden gar nicht mehr. Der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen war dafür ein gutes Beispiel.
Haben Sie auch eines für guten Trotz?
Strigl: Beispiele für bewundernswerten Trotz sind für mich jene Menschen, die bei der Abstimmung über den "Anschluss" im März 1938 mit Nein gestimmt haben. In Altaussee und Schlierbach hat jeweils eine einzige Person mit Nein gestimmt. Beide haben gewusst, dass es alle anderen wissen. Es hat in dem Moment nichts bewirkt. Aber es hat auf lange Sicht zur Folge, dass man den Glauben an den Menschen aufrechterhalten kann.
Und in der jüngeren Vergangenheit?
Strigl: Aufgrund der Besetzung der Hainburger Au im Dezember 1984 wurde das Kraftwerk nicht gebaut.
Heute scheint die Klimabewegung mit ihren Aktionen kaum Rückhalt in der breiten Bevölkerung zu haben, obwohl ihr Anliegen uns alle betrifft. Was hat sich da in den vergangenen vierzig Jahren geändert?
Strigl: Es hat mit dem apokalyptischen Szenario zu tun, das uns die Aktivistinnen und Aktivisten vor Augen führen. Man will Dinge nicht wahrhaben, obwohl man sie weiß, und reagiert daher negativ auf jene, die einen damit konfrontieren.
Die ungeliebte Kassandra?
Strigl: Ja. Im Gegensatz zu den Au-Besetzern damals setzt die Klimabewegung heute auf Störfaktoren im Alltag. Dadurch haben sie viele verprellt, die eigentlich mit ihnen sympathisieren würden. Zwar haben auch die Au-Besetzer ihre eigene Haut zu Markte getragen und riskiert, dass sie grob angepackt oder verprügelt werden, aber sie haben etwa nicht ständig den Straßenverkehr blockiert. Wobei ich aber ohnedies glaube, dass die Ablehnung weit darüber hinausgeht: Viele zweifeln an der Sinnhaftigkeit dieser Aktionen, weil sie resigniert haben. Sie nehmen das Szenario vom Untergang der Welt als nicht mehr abwendbar wahr. Also: Wir haben sie zerstört, und das lässt sich jetzt nicht mehr ändern.
Das Gegenteil von Trotz ist also Resignation?
Strigl: Ja, und es kommt noch etwas zum Trotz dazu: das Aufbegehren. Denn Trotz lässt sich nicht besänftigen, wenn man den Trotzigen vor Augen führt, dass ihr Tun keinen Sinn hat. Der Trotzige ist grundsätzlich bereit, diesen Trotz auch ohne Aussicht auf ein gutes Ende durchzuhalten. Und wenn es nichts nützt, was sich oft schon abzeichnet, dann hat man es wenigstens versucht.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie ein trotziges Kind waren.
Strigl: Ein Buchthema wählt man nicht zufällig aus. Das findet einen auch. Als trotziges Kind zu gelten, war eine Bürde. Auch in der Pubertät. Und bei mir hat sich der Trotz offenbar verfestigt. Ich bin heute noch trotzig, wenn auch in einer anderen Ausprägung. verglichen, mit Michael Kohlhaas. Wie war das gemeint?
Strigl: Das war ein Negativbeispiel. Damals wusste ich nicht, wer Kohlhaas ist. Erst später habe ich die Novelle von Heinrich von Kleist gelesen.
Heinrich von Kleists Novelle "Michael Kohlhaas" erschien 1810 und spielt Mitte des 16. Jahrhunderts. Ihr Protagonist Michael Kohlhaas ist ein Pferdehändler, dem Unrecht geschieht. Auf der Burg eines Junkers, eines Edelmanns, werden ihm auf einer Reise zwei seiner Tiere als Pfand abgenommen und rücksichtslos für schwere Arbeit eingesetzt. Als Kohlhaas sie zurückverlangt, sind sie abgemagert und für ihn wertlos geworden. Er reicht Klage beim Kurfürsten ein. Doch er hat keine Chance gegen die Obrigkeit. Schließlich kommt seine Frau zu Tode, die ihn unterstützen wollte. Kohlhaas hat nichts mehr zu verlieren, will sich an dem Junker rächen, führt einen Haufen Bewaffneter an und tötet viele Unschuldige. Am Ende muss der Junker zwar Schadenersatz leisten, aber Kohlhaas wird wegen Landfriedensbruchs hingerichtet.
Strigl: Die Geschichte geht schlecht aus, auch wenn der Held mit sich selbst im Reinen ist. Das ist kein Vorbild, das man einem Kind geben möchte. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass meine Eltern, beide Juristen, auch Respekt vor Kohlhaas' Hartnäckigkeit gehabt haben, vor seiner Spitzfindigkeit und der Präzision, mit der er vorgeht.
Weil er durch die Instanzen gegangen ist.
Strigl: Ja, dass er als Nicht-Jurist, so wie Kleist es beschreibt, zunächst alle juristischen Möglichkeiten ausschöpft und sich um Gerechtigkeit bemüht. Erst als die Obrigkeit den Weg der Korrektheit verlässt, kommt er auch davon ab.
An welchem Punkt muss man aufhören, auf seinem Recht zu beharren?
Strigl: Die Grenze ist da, wo nicht nur Gesetze gebrochen werden, sondern Menschen zu Schaden kommen. Wie bei Kohlhaas. Bei einem seiner Überfälle werden Frauen und Kinder getötet. Auch in unserem heutigen Rechtssystem gibt es die Notwehrüberschreitung. Wenn mich jemand angreift und ich könnte ihn mit Pfefferspray außer Gefecht setzen, bringe ihn aber sofort um, ist das nicht mehr Notwehr.
Viele der trotzigen Figuren in Ihrem Buch sind Männer. Ist der Trotz männlich?
Strigl: Für die Literaturgeschichte kann man das sagen, weil Trotz seit dem Mittelalter mit kriegerischem Handeln verbunden ist. Trotz hat mit Ehre zu tun und vor allem auch mit militärischem Kampf oder Widerstand. Für die Frau im Patriarchat war lange Zeit nicht vorgesehen, dass sie sich handgreiflich wehrt oder gar kriegerisch agiert. Deshalb ist Jeanne d'Arc eine solche Ausnahmefigur.
Was zeichnet sie aus?
Strigl: Sie war im hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England nicht nur Soldatin, was schon ungewöhnlich genug gewesen wäre, sondern sie hat auch ein Heer angeführt. Aber im Allgemeinen war die Rolle der Rebellin in der Literatur nicht vorgesehen. Trotzige Frauen wurden meistens als "trotziges Kind" hingestellt. Ein gutes Beispiel ist Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung" aus dem Jahr 1594.
Warum?
Strigl: Die Protagonistin Katharina ist eine kluge und rhetorisch brillante Widersacherin ihres Ehemanns, bevor sie von ihm "gezähmt" wird, wie man das nannte. Von der Stücklogik her ist diese Zähmung schwer nachzuvollziehen. Shakespeare hat damit das damals gängige Komödienmuster durchbrochen, indem er Katharina zu einer interessanten und witzigen Figur nobilitiert hat. Aber am Schluss erfüllt er wieder das Klischee. Die zänkische Ehefrau wird fügsam.
Ein jüngeres Beispiel dieser Geschichte finden wir im "Trotzkopf", Emmy von Rhodens 1885 erschienenem Erfolgsroman.
Strigl: Für mich war das ein ärgerliches Leseerlebnis. Das Buch ist zwar nicht schlecht geschrieben, aber es hat diese Ideologie des Heiratsfähigmachens von Mädchen auf die Spitze getrieben. Es ist bis heute international ein Dauerbrenner.
Wie erklären Sie sich das?
Strigl: Es finden sich immer wieder junge Leserinnen, die ihre eigene Rolle hinterfragen.
Ilse, der titelgebende "Trotzkopf", wächst auf dem Gutshof ihres Vaters auf. Sie reitet, zieht keine schönen Kleider an, hat schmutzige Stiefel und widerspricht den Erwachsenen. Sie kommt in ein Mädchenpensionat, wo sie, nach dem bürgerlichen Wertekatalog der Zeit, zur Sanftmut erzogen und damit ehetauglich gemacht werden soll.
Strigl: Aus heutiger Sicht wird Ilse gebrochen. Damals sagte man, sie werde klüger, vernünftiger, kurz: erwachsen. Natürlich hat Erwachsenwerden mit der Überwindung von Trotz zu tun, aber hier wird vorgeführt, dass vernünftig zu werden heißt, sogenannte weibliche Tugenden zu erlernen: sauber, adrett und hübsch zu sein und vor allem: nicht zu widersprechen.
Und die Erzieherinnen seien ja sehr gütig, heißt es.
Strigl: Ilse war in keiner Prügelschule. Aber dennoch ist es demütigend, als rabiates Mädchen vorgeführt zu werden, während alle anderen sanftmütig sind. Das waren die Ideale des 19. Jahrhunderts, aber sie sind auch heute noch unausgesprochen wirksam.
Wie konnte es eigentlich jemals zu einer derart unkonventionellen Frauenfigur wie Antigone kommen?
Strigl: Das ist für mich ein Wunder.
Die Tragödie "Antigone" des griechischen Dichters Sophokles wurde im Jahr 442 vor Christus uraufgeführt. Antigone lebt in Theben. Ihre beiden Brüder Eteokles und Polyneikes sollen sich die Herrschaft teilen, sind aber verfeindet. Bei einer Schlacht vor den Toren der Stadt kommen beide zu Tode. Kreon, der Onkel der Geschwister, verfügt als Interimskönig, dass Polyneikes, der gegen Theben gezogen war, nicht begraben werden darf. Antigone widersetzt sich dieser Anordnung, obwohl sie weiß, dass darauf die Todesstrafe steht. Kreon lässt sie am Ende lebendig einmauern. Als er doch noch einlenkt und sie freilassen will, hat Antigone bereits Suizid begangen und mit ihr Kreons Sohn, ihr Verlobter, sowie dessen Mutter, Kreons Frau.
Strigl: Sophokles hat Antigone gegen die Männerwelt inszeniert. Das ist hochmodern und aus dem historischen Kontext nicht zu verstehen. Er macht klar, dass sie zwar stur ist, aber gute Gründe dafür hat. Und er bezeichnet auch ihren Onkel, Kreon, als trotzig. Am Ende ist er es, der nicht nachgibt und auf allen Linien der Besiegte ist.
Aber könnte man das nicht auch anders interpretieren? In unserem heutigen Rechtsstaat gibt es Gesetze, die wir nicht für gut befinden. Ist es deshalb gleich gerechtfertigt, gegen staatliche Regeln zu verstoßen?
Strigl: Bis zum Tod von Antigones Brüdern war es ein allgemeines Gesetz, dass man Tote selbst dann bestattet, wenn sie Feinde waren. Das war eine religiöse und sittliche Pflicht. Kreon verstößt mit seinem neuen Gesetz gegen dieses Gebot. Goethe etwa hat dazu gesagt, dass man nichts, was aus Staatsräson gemacht wird, aber gegen das sittliche Empfinden verstößt, eine Tugend nennen darf. Er ist der Ansicht, dass Kreon seinen Feind gehasst und die Staatsräson als Vorwand benutzt hat, um diesen Feind zu missachten.
Antigones Handlung können wir nachvollziehen: Tote müssen begraben werden. Aber das Empfinden von "richtig" und "falsch" ist von Mensch zu Mensch verschieden. Wann rechtfertigt das sittliche Empfinden Widerstand gegen die Staatsgewalt?
Strigl: Es gibt eine Übereinkunft, auch zwischen den Kulturen, wie man mit Toten zu verfahren hat, nämlich dass man sie bestattet. Am Beispiel der Wilderer im 19. Jahrhundert habe ich versucht zu zeigen, welches sittliche Empfinden man in Bezug auf Eigentum haben kann. Bricht jemand in einen Garten ein und stiehlt etwas, ist er ein Dieb. Nimmt jemand aus einem Wald, der ja auch jemandem gehört, Schwammerln oder Beeren mit nachhause, haben wir wahrscheinlich Scheu davor, das genauso streng zu sehen. Weil man gegenüber der freien Natur ein anderes Eigentumsbewusstsein hat. Es gibt gewisse kulturell gewachsene Vorstellungen von Sittlichkeit, aber natürlich auch Grenzfälle.
Keine literarische, sondern eine historische Figur ist der indische Jurist und Pazifist Mahatma Gandhi. War er in seinem gewaltfreien Widerstand trotzig?
Strigl: Gandhi trotzig zu nennen wäre ein bisschen verkleinernd. Von der Wortbedeutung her hat er der Kolonialmacht zwar getrotzt. Aber nicht jeder Widerstandskämpfer ist trotzig. Trotz im Politischen passiert dann, wenn man aus dem Bauch heraus handelt. Aus einem Gefühl der Ungerechtigkeit heraus. Das war bei Gandhi auch im Spiel. Aber das war doch mehr, ein revolutionärer langer Atem. Er führte eine wohldurchdachte und wohlbegründete Widerstandsbewegung an. Auch die Mittel waren wohlüberlegt.
Trotz und Rationalität widersprechen einander also ein Stück weit?
Strigl: Trotz ist zum Beispiel der Tiroler Freiheitskampf 1809. Da war eine Unzufriedenheit da. Man hat sich durch die bayerische Besatzung in seinen gewohnten Rechten beschnitten gesehen, und das entlud sich in der Folge impulsiv. Der antikoloniale Kampf in Indien ist ungleich länger gewachsen. Ein Rebell ist trotzig, ein Revolutionär ist es nicht. Er hat eine längere Perspektive und ein größeres politisches Reflexionsbemühen.
Am Ende Ihres Buches halten Sie auch ein Plädoyer für die Literatur. Warum?
Strigl: Literaturaffinität ist nichts rein Individuelles. Vielmehr macht sie eine Gesellschaft aus -oder eben nicht. Literatur ist keine Privatsache. Mich interessiert, ob Literatur einen Wert in der Gesellschaft darstellt. Und momentan tut sie das nicht.
Wie kommen Sie darauf?
Strigl: Man kann sich heute damit brüsten, ungebildet zu sein und nichts gelesen zu haben. Das sieht man an den Lehrplänen der Schulen. Es wird keine Literaturgeschichte mehr unterrichtet, die diesen Namen verdient. Auch an der Uni sinkt das Niveau. Das ist ein Kreislauf. Die Jugendlichen an den Schulen werden von Lehrern unterrichtet, die ein Schmalspurstudium hinter sich haben. Wie soll man Begeisterung für Literatur vermitteln, wenn man selbst rudimentäre Kenntnisse hat? Der Kanon wird immer enger. Früher hat es viel mehr Bücher gegeben, über die man gesprochen hat, die eine Generation geprägt haben. Heute ist der Diskurs in der Gesellschaft verarmt.
Welchen gesellschaftlichen Wert hat das Lesen?
Strigl: Lesen heißt immer auch kritisieren. Man liest einen Text, man verhält sich zu ihm. Das kritische Bewusstsein von Jugendlichen wird auch durch Lesen geformt. Und lesen muss man genauso üben wie andere Dinge. Das geht nicht mit nur einem "Ganztext" in der gesamten Oberstufe.
Einem "Ganztext"?
Strigl: Einem Buch. Die Fachdidaktik verwendet ohne Schamesröte den Begriff "Ganztext" dafür. Wir sind zunehmend einem Nützlichkeitsregime unterworfen. Und dieses Nützlichkeitsdenken ist eng mit dem ökonomischen Denken verwandt. Immer heißt es, die Schule soll kritisches Denken fördern, aber das ist nur verlogenes Getue. De facto sollen unsere Schulen offenkundig etwas ganz anderes leisten.
Wie meinen Sie das?
Strigl: Die Jugendlichen müssen sieben verschiedene "Textsorten" einstudieren und bei der Matura reproduzieren. Das macht niemandem Spaß. Ein Kollege meinte, er halte es für unsinnig, das Schreiben von Leserbriefen zu üben. Stattdessen sollte man lieber Schiller lesen. Damit erhalte man automatisch auch die rhetorischen Fähigkeiten, um einen Leserbrief verfassen zu können. Ich denke, damit hat er recht.