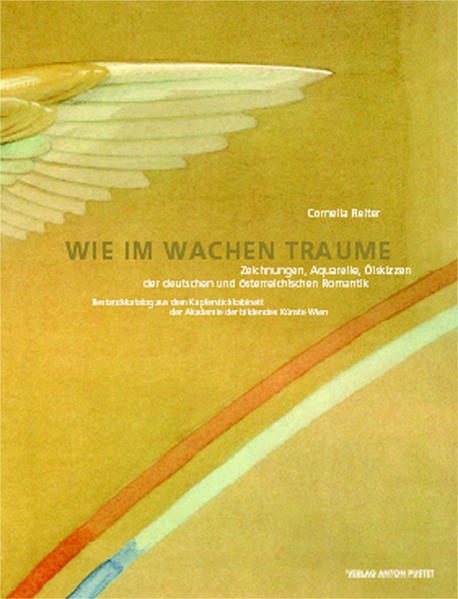Die reaktionäre Avantgarde
Matthias Dusini in FALTER 52/2015 vom 23.12.2015 (S. 32)
Liebe ohne Sex und Erfolg ohne Geld: Wie die Kunst der in Wien gegründeten Nazarener-Gruppe den romantischen Gefühlen eine Form gab
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Die Kerzen strahlen, das Lametta glitzert. Die Eltern sind gerührt von den glänzenden Augen der Kinder. Für diese Gemütsbewegung wurde Anfang des 19. Jahrhunderts das Wort „romantisch“ gefunden.
Als die jüdische Großbürgerin Fanny von Arnstein zu Weihnachten 1814, während des Wiener Kongresses, zum ersten Mal einen Christbaum aufstellte, war das auch ein politisches Signal. Arnstein versammelte in ihrem Salon einen Kreis von Konvertiten, die in der katholischen Weihrauchreligion ein halluzinogenes Gegenprogramm zur nüchternen Aufklärung entdeckten.
Der deutsche Wald löste das antike Griechenland als Imaginationsraum für politische Fantasien ab, der Kerzenschein das grelle Licht der Vernunft. Man bekämpfte den Tugendterror der Jakobiner durch Märchen und Mütchen. Eine Gruppe junger Künstler aus dem Dunstkreis Fanny Arnsteins, die Nazarener, lieferte dazu mehr als nur einen kunstgeschichtlichen Beitrag.
Eine Ausstellung in der Albertina erzählt ihre Geschichte. Sie handelt von einer Religion für Aufgeklärte, von Weltflucht und Unternehmertum. Die Nazarener (Lukasbrüder) waren die erste Avantgardebewegung, die die Fusion von Kunst und Leben propagierte. Von vielen wird diese von den Nazis als Ausdruck deutscher Tiefe vereinnahmte Kunst als Kitsch abgelehnt. Es spricht einiges für eine Revision.
Moralische Revolution
Im Jahr 1809 fand, mitten in den napoleonischen Kriegen, an der Akademie der bildenden Künste Wien ein Kreis junger Maler zusammen. Gemeinsam war ihnen die Ablehnung der herrschenden Lehrmeinung. Sie hatten genug vom stumpfen Abzeichnen von Büsten und Skeletten, der Imitation der „Gipsantike“, wie man die altrömischen Vorbilder spöttischerweise nannte. „Man lernt einen vortrefflichen Faltenwurf malen, eine richtige Figur zeichnen. Eins fehlt in allen neueren Gemälden – Herz, Seele und Empfindung“, schrieb der 19-jährige Friedrich Overbeck aus Lübeck in einem Brief an seinen Vater.
Nach dem Schutzpatron mittelalterlicher Malergilden, dem Evangelisten Lukas, nannten sich die Anti-Akademiker „Lukasbrüder“. Sie forderten eine „neudeutsche, religiös-patriotische Kunst“, die mehr Herz als Kopf war. Overbeck und seine Kollegen ließen sich die Haare wachsen und wollten leben wie Mönche, die Welt durch eine Veränderung des Bewusstseins verbessern. Sie nannten die Bewegungslehre von Krise und Rettung eine „moralische Revolution“. Im Mai 1810 zogen die Lukasbrüder Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Joseph Sutter, Josef Wintergerst, Ludwig Vogel und Josef Hottinger nach Rom und gründeten eine Kommune. Ein von der napoleonischen Besatzung säkularisiertes irländisches Franziskanerkloster stand leer. Hier wohnten die Künstler in Mönchszellen und benutzten den ehemaligen Speisesaal als gemeinsames Atelier. Mit ihrer Dissidenz schufen die Nazarener ein Modell für alle Aussteiger. Am Anfang steht immer ein Knacks, der das bisherige Leben wertlos wirken lässt und zu einem Erweckungserlebnis führt. Mit der Abspaltung geht ein Gefühl der Vereinzelung einher, das von der Gruppe kompensiert wird. Die Anerkennung durch die ähnlich Empfindenden schafft ein Wir-Gefühl, das darüber hinweghilft, dass die Umgebung ablehnend reagiert.
In den Wohngemeinschaften um 1800 hat jener männliche Freundschaftskult seine Wurzeln, der die Grundlage für viele kommende Band- und Gangprojekte bildet. Wenn sich pubertierende Jungs zusammentun, entsteht eine explosive Mischung.
Geregelter Underground
Die Künstler ließen das prunkvolle Rom der Cäsaren und Päpste links liegen und malten das gebirgige Hinterland, wo sich seit der Spätantike die Einsiedler niederließen. Die Lukasbrüder griffen auf alte Ordensregeln zurück, die den Aufbau einer alternativen Lebensform erleichterten. Der vom heiligen Benedikt ausgegebene Befehl „Ora et labora!“ – „Bete und arbeite!“ – eignete sich dafür, den Alltag im Underground zu strukturieren.
Ein Kennzeichen von Secessionsbewegungen ist es, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Alle äußerlichen Ornamente der Existenz, etwa der Konsum von Alkohol, werden gestrichen, um der inneren Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Bei den Nazarenern äußerte sich dieser Purismus in einer Abwertung handwerklicher Virtuosität. Man hatte auf der Akademie alle Tricks gelernt, wendete sie aber nicht an, weil sie als gekünstelt galten. Was nicht schlicht ist, ist schlecht.
Die Lukasbrüder porträtierten sich gegenseitig und verzichteten dabei auf eine genaue Wiedergabe der Person. „Den Charakter richtig auffassen, aber von irdischen Mängeln reinigen, ist der Endzweck eines Bildnisses“, schrieb Friedrich Overbeck in sein Tagebuch. Wer nicht die äußere Natur nachahmte, sondern das Wesen erfasste, hatte die Prüfung bestanden.
Nichts sollte von der Person ablenken: die Köpfe sind frei – ohne Statussymbole im Hintergrund – auf die neutrale Fläche des Papiers gesetzt. Die spätmittelalterliche Drucktechnik des Holzschnitts mit seinen harten Strichen eignete sich als Medium für den beabsichtigten Primitivismus.Der visuellen Ekstase in den Barockkuppeln wollte man eine ehrliche, naive Malerei entgegensetzen, dem fetten Kohlestrich der akademischen Lehrer die feine, strenge Linie eines neu entwickelten Werkzeugs, des Bleistifts. Auch bei den Farben waren die Nazarener anders. Statt illusionistischer Hell-Dunkel-Übergänge, wie sie im Barock üblich waren, setzten sie auf flächig wirkende Eigenfarben. Dieser zweidimensionale Effekt ist aus Comics und Kinderbüchern bekannt, jedes Ding hat einen Umriss und seinen eigenen Farbton. Die Arbeit am Selbst verwob Ethik mit Ästhetik – und Askese mit Karriere.
Geld und Liebe
Auch bei den Vertretern heutiger Konsumkritik stehen Gutsein und Glut hoch im Kurs. In Projekträumen und Start-ups der Weltverbesserung lässt der Glaube an etwas Höheres die Herzen schneller schlagen. Das Feeling übertrumpft das kaufmännische Kalkül, was der idealistischen Branche einen zweifelhaften Ruf einbrachte: Selbstverwirklichung bedeutet meist förderungswürdig, aber unrentabel.
Die geringe Kreditwürdigkeit der Romantik hängt mit dem Verbot zusammen, mit dem Kontor zu kooperieren. Wer von Wahrheit spricht, schweigt, wenn es um Bankdarlehen geht. Trotz des Armutsgelübdes hatten die Nazarener einen ungeheuren Erfolg. Eine Handvoll Studenten initiierte eine der einflussreichsten Kunstbewegungen des 19. Jahrhunderts. Das zeigt sich etwa daran, dass mehrere Lukasbrüder später Professuren bekamen.
Sie formten aus dem römischen Workshop-Modell die modernen Meisterklassen der Akademien. In dieser teilweise heute noch gängigen Unterrichtsform geht es darum, dass der Lehrer nicht diktiert, sondern Begabungen fördert. Auf dem Lehrplan steht nicht die Reproduktion, sondern die Intuition. Nach anfänglicher Skepsis erkannten die Herrscher in Wien und München das Potenzial romantischer Erzählungen und ließen sich, etwa in der Franzensburg in Laxenburg bei Mödling, als Ritter in Szene setzen. Der Imagetransfer vom Traum in die Politik war vollzogen.
Auch das Produktionsmodell machte Schule. Die aus der Dürer-Zeit entlehnte Idee der Künstlergilde wurde mehrfach fortgeführt. Auch wenn der heutige Besucher die Verwandtschaft schwer erkennt: Ein aus der Nazarenerschule stammender Bau wie die Kirche St. Johann Nepomuk in der Praterstraße hat bereits die Charakteristiken des Gebäudes der Wiener Secession. Künstler, Architekten und Kunsthandwerker entwerfen gemeinsam einen Tempel, dessen Form aus einer vergangenen Epoche in die Gegenwart gepaust wird.
Die romantische Ökonomie propagierte die Selbstständigkeit gegenüber der feudalen Abhängigkeit von Kirche und Hof. Die Nazarener entwickelten Karrierestrategien für den Geniemarkt, auf dem öffentliche Prominenz das höfische Insiderwissen verdrängte. Die jungen Römer wurden schnell zum Hype, auch deshalb, weil die gemeinsam entwickelte Formensprache so etwas wie eine Corporate Identity ermöglichte.
Wie in späteren Reformschulen, etwa der Wiener Werkstätte oder dem Bauhaus, stellte das Individuum seine Originalität zugunsten eines anonymen Kollektivs zurück. Durch die gemeinsame Arbeit am Werk erprobte man ein konzeptuelles Programm, das die Idee höher wertete als die Ausführung.
Das Outfit und der Lebensstil hoben sich so stark von der Umgebung ab, dass die bescheidenen Brüder bald der Mittelpunkt der Kunststadt waren. Aus ganz Europa reisten junge Künstler nach Rom, um die antiken Vorbilder, Michelangelo und Raffael zu studieren. Die Popularität der Bewegung hing auch mit der kontrastreichen Malweise zusammen, die in der mechanischen Reproduktion gut zur Geltung kam.
Auch die vergessene und von den Nazarenern wiederentdeckte Freskotechnik hatte eine massenmediale Qualität. Erste Aufträge in Italien gaben den Künstlern die Gelegenheit, den Werbeeffekt von Wandbildern zu erproben. Fresken mit patriotischen Szenen werden die Rathäuser, Parlamente und Theater des 19. Jahrhunderts in öffentliche Räume verwandeln.
Das Volk ist der Adressat politisch engagierter Künstler, nur wenige waren mit ihrer Botschaft so erfolgreich wie die Avantgarde der Reaktion. Ihr Einfluss beschränkt sich nicht auf die Fantasy-Ästhetik, die ihre Zauberwelten mit Einhörnern, Einsiedlern und Gralssuchern besiedelt. Die Romantik hat auch das Image von Mann und Frau verändert.
Rokoko-Schlampen
Beim Candle-Light-Dinner vergessen die Verliebten den animalischen Ursprung ihrer Zuneigung. Romantik heißt Widerstand gegen das Triebleben, Veredelung der irdischen Säfte und Kräfte. Wenn Teenie-Idole und Hollywoodfilme die Unschuld von Märchenprinzen vermitteln, dann hat das mit Klischees zu tun, die im frühen 19. Jahrhundert entwickelt wurden.
Die romantische Ideologie unbefleckter Reinheit infizierte das Bild der Geschlechter. Aus der Rokoko-Schlampe wurde das süße Mädel, aus Galanterie die Religion einer Liebe ohne Sex.
Ein Programmbild der Nazarener zeigt zwei biblische Frauenfiguren, „Sulamith und Maria“ (1811), als Verkörperung idealer Weiblichkeit. Franz Pforr widmete das Bild Friedrich Overbeck, als Ausdruck seiner Freundschaft. Der Bildraum ist zweigeteilt: Links spielt eine Mutter mit ihrem Baby in einem südlichen Garten, rechts sitzt ein Mädchen in einem gotischen Schlafzimmer und flicht das lange Haar zu Zöpfen.Die Aufwertung des Gefühls in der bürgerlichen Gesellschaft teilte der Frau die Bereiche Pflege und Kosmetik zu. Die Romantiker entwarfen Geschlechterstereotype, die sich den Angriffen feministischer Aufklärung gegenüber als resistent erwiesen – Muttis und Tussis. Moderne Varianten von „Sulamith und Maria“ sind aus der Werbung vertraut: Frau mit Kind im Biogarten oder beim Föhnen am Schminktisch.
Die Lukasbrüder abstrahierten Individuen zu Allegorien, deren dunkle Seite in Gestalt verführerischer Hexen und lasziver Sünderinnen zum Vorschein kam. Auch das ist ein romantischer Evergreen: Die Anbetung der Geliebten geht mit der Scheu einher, sie zu berühren. In der Popkultur wird sich religiöse Andacht in devotes Fantum verwandeln.
Als die keuschen Boys in ein römisches Kloster zogen, vermieden sie die Begegnung mit Frauen. Sie beschränkten sich beim Aktstudium auf männliche Modelle, und als dann irgendwann auch Mädchen ins Atelier kamen, waren das brave Bauerntöchter in langem Rock und Begleitung von Verwandten.
„Die doppelte Struktur eines idealen Begehrens und einer Furcht vor der damit verbundenen Wirklichkeit ist eine neurotische Struktur der Romantik“, schreibt der Kunsthistoriker Holger Birkholz im Ausstellungskatalog. 200 Jahre später reagiert man auf den neurotischen Romantiker mit juristischen Mitteln. Der Inbegriff vermeintlich selbstloser Leidenschaft hat seine kriminelle Energie oft genug gezeigt. Wer sich nicht im Griff hat, muss mit einem Kontaktverbot rechnen. Der Mann mit dem Süßholz sitzt wegen Stalkings auf der Anklagebank.
Der aufgeklärte Betrachter erahnt in den Bildern von den frommen Nazarenerinnen das Zwanghafte ihrer Herstellung. Dieser Verdacht lässt sich auch nicht durch den Hinweis zerstreuen, dass das abstinente Leben seinerzeit als Befreiung von der Frivolität der höfischen Gesellschaft galt. Man spürt es auch beim Studium von Wachturm-Heften und Plakaten aus der Sowjetzeit: Wer allzu gesund ausschaut, muss durch die Hölle gegangen sein.
Diese Skepsis ist nichts Neues. Das Gutmenschentum der Nazarener zog von Anfang an Häme auf sich. „Gott weiß, dass ich meinen Bruder lieb habe, aber seiner Kunst, der will ich nicht wohl. Hat ihr die Luft in Wien geschadet oder ist sie schwindsüchtig geworden?“, schrieb der Künstler Julius Schnorr von Carolsfeld seinem Vater nach Leipzig. Das merkwürdige Verhalten seines Bruders Ludwig Ferdinand, auch er ein Künstler, machte ihm Sorgen.
Ludwig Ferdinand nahm an Séancen teil, in denen die Romantiker den Kontakt zur Geisterwelt suchten. Er malte die heilige Cäcilia als Trancefigur, die in einem Kranz von Regenbogenfarben schwebt. Julius Schnorr waren diese schamanistischen Experimente suspekt: Jesus und seine Apostel „machten keine so dummen Fickfackeleien, sie hatten keine Regenbogenvisionen“.
Gutmenschen in Trance
Der Spott über die Romantik und ihren Bruder, den Kitsch, ist so alt wie die Bewegung selbst. Die Aufklärer hatten den Spuk des Mittelalters gerade hinter sich gelassen, nun kam der Aberglaube als Kult einer Künstlersekte zurück. Die Naturwissenschaften nahmen der Nacht und dem Gewitter ihren metaphysischen Schrecken, den die Antirationalisten nun mit wohligem Schauer wiederbelebten. Napoleon brach die Macht des Papstes, und nun konvertierten Jugendliche der Reihe nach zur Religion des Ancien Régime.
Doch auch diese längst enttarnte Propaganda der Unschuld enthält ein befreiendes Moment. Die Nazarener machten ja nicht nur Frauen jungfräulich, sondern auch Männer weiblich. Statt muskulöser antiker Helden zeichneten die Künstler weiche Teenager, formatierten den christlichen Rachegott zum sanften Jesus Christ Superstar um. Das schulterlange Haar ging als Prototyp sensibler Friedfertigkeit in die Geschichte der Mannsbilder ein. „Männliche Empfindsamkeit wird durch die Transformation in die weibliche Hülle darstellbar“, schreibt Holger Birkholz.
So mischte sich in die Ablehnung der als feminin empfundenen Kunst auch ein homophobes Ressentiment. Wer Gemüt zulässt, kann kein Hetero sein. Oder umgekehrt: Erstmals durften Männer Gefühle zeigen.
Die Albertina vermittelt die Nazarener gemeinsam mit den ungleich bekannteren Caspar David Friedrich und Francisco Goya, als wollte man die Wirkung des Süßstoffes dämpfen. Dabei haben diese Dokumente einen eigenen Platz in der Überlieferung verdient – als sozialistischer Realismus des Unendlichen, als engagierte Kunst des Eskapismus. Durch die Bilder blasser Madonnen und mondbeschienener Schlossruinen schimmert die Moderne in ihrer Ambivalenz von Fortschritt und Verlust, Erlösung und Sehnsucht durch.
Als die Götter sich von der Erde verabschiedeten, hinterließen sie ein spirituelles Betriebssystem, das zugleich Schönheit und Schrecken verbreitet – die Romantik.