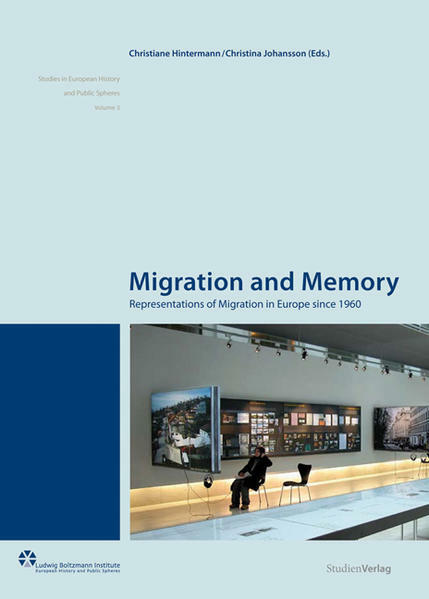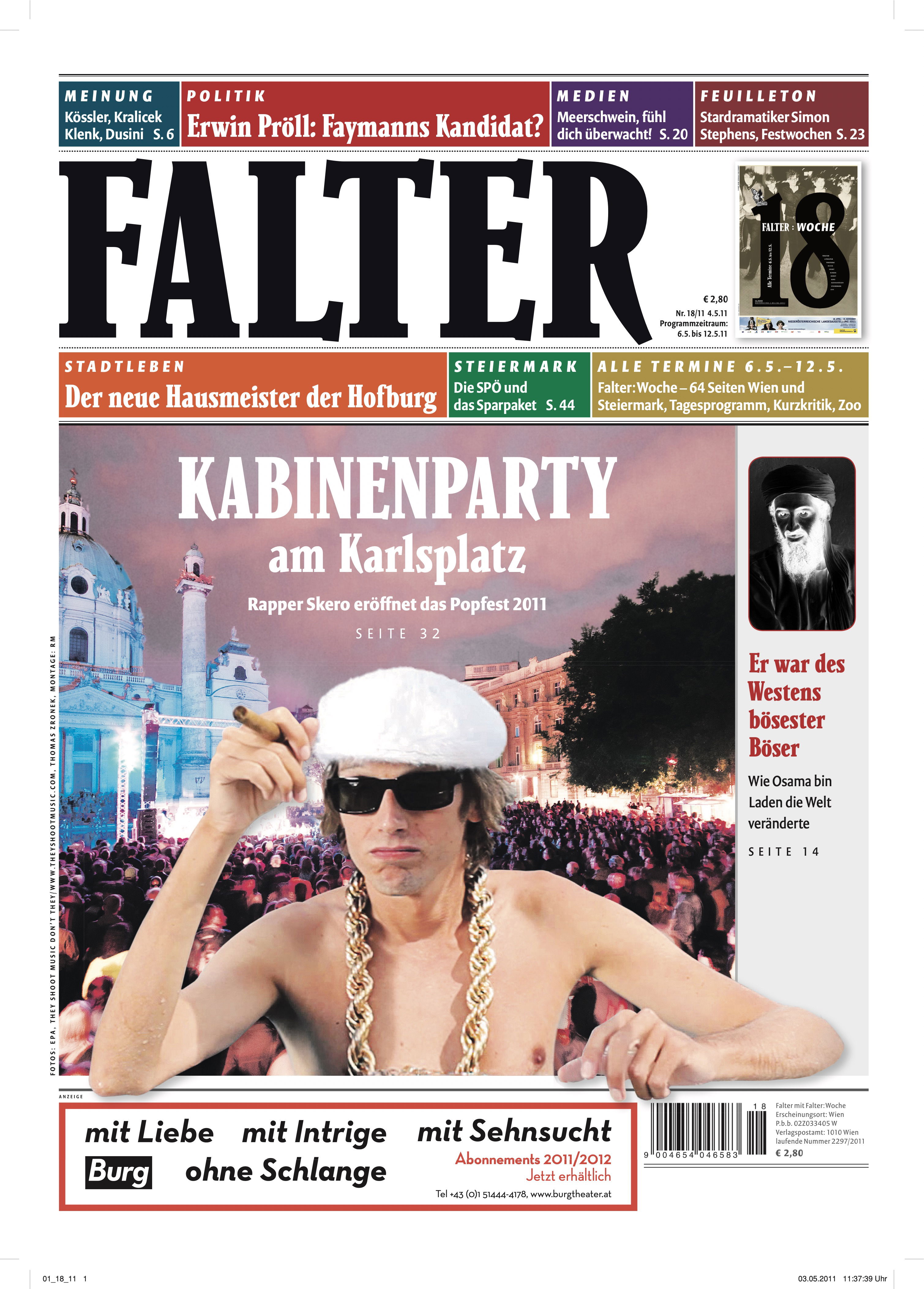
Wie bastelt man sich ein Einwanderungsland?
Marion Bacher in FALTER 18/2011 vom 04.05.2011 (S. 16)
Österreich sei ein Einwanderungsland, sagt Sebastian Kurz. Der Vergleich mit Schweden zeigt, dass es noch viel lernen muss.
Was haben der Schwede Tobias Billström und der Österreicher Sebastian Kurz gemeinsam? Die blonden Haare. Die blauen Augen. Das adrette, fast schon geschleckte Auftreten. Ideologisch sind beide in wertekonservativen Parteien zu Hause, wenn auch Billströms Partei – die Moderaten – einen wirtschaftlich weitaus liberaleren Kurs als die ÖVP verfolgt. Abgesehen davon, dass sie die Jüngsten in ihren Regierungen sind, beackern sie ein ähnliches Feld: Billström ist seit 2006 schwedischer Migrationsminister, Kurz seit zwei Wochen Integrationsstaatssekretär.
Sein bis dato wichtigstes integrationspolitisches Bekenntnis: Deutsch sei der Schlüssel zur Integration, und deshalb müsse jeder die Chance bekommen, die Sprache "optimal" zu lernen. Was Kurz anstrebt, setzen die Schweden schon seit fast 50 Jahren um: Als die Österreicher noch daran glaubten, dass die "Gastarbeiter" am Ende wieder das Land verlassen würden, boten die Schweden ihren Arbeitsmigranten kostenlose Schwedischkurse und muttersprachlichen Unterricht für deren Kinder. Billström und Kurz waren damals noch nicht geboren; über "Migrationsfragen" diskutierten hier wie dort vor allem die Gewerkschaften; und vor Arbeitsmigranten fürchtete man sich noch nicht.
Heute sind nur mehr qualifizierte Zuwanderer erwünscht, über "Ausländer" wird im Innenministerium debattiert, und jedes Einwanderungsland hat mittlerweile seinen Migrationsminister, Asylpolitiker, Integrationsstaatssekretär. Die Diskussion über "die anderen" und über "uns" ist längst nicht nur im Parlament und an den Wirtshaustischen angekommen. Sie spiegelt sich in Schulbüchern, Museen, im öffentlichen Raum wider.
Schulbücher als Beispiel
Österreichische und schwedische Historiker haben in Zusammenarbeit mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte zwei spannende Sammelbände herausgegeben. "Migration and Memory" dokumentiert, welchen Stellenwert Migrations- und Integrationsgeschichten in nationalen Geschichtsnarrativen haben. Als Gradmesser dienen den Autorinnen Schulbücher und Museen. Es geht also um genau jene Erinnerungsorte, wo Mehrheitsmeinungen vorläufig ausdiskutiert sind oder die Schlacht erst am Anfang ist.
In "Debating Migration" vergleichen die Autoren, wie der politische Diskurs über Arbeitsmigranten in Österreich und Schweden abgelaufen ist. Warum ent-
schied sich Österreich für das Rotationsprinzip, als es Arbeiter in Jugoslawien und in der Türkei anwarb? Und warum ging Schweden davon aus, dass Migranten kommen, arbeiten und bleiben würden? Der zweite Sammelband skizziert, wie es zu solchen Entscheidungen kam, wie Gewerkschaften, Parteien argumentierten und welche Stellung die Medien dazu einnahmen.
Die Analysen bleiben nicht in den 60er- Jahren hängen, sondern führen den Leser bis in die Gegenwart: Der Fall des Eisernen Vorhangs, die Jugoslawienkriege und der EU-Beitritt von zehn osteuropäischen Ländern 2004 prägten das Bild von Arbeitsmigranten und die Migrationspolitik
maßgeblich. Während schwedische Politiker argumentierten, dass es der Wirtschaft guttun würde, wenn man den Arbeitsmarkt für die EU-Neulinge sofort öffnen würde, fürchteten sich die österreichischen Entscheidungsträger vor Lohndumping. Das Resultat der Diskussion ist wenig überraschend: In Österreich dürfen die "neuen" EU-Bürger erst seit 1. Mai 2011 uneingeschränkt arbeiten, in Schweden
seit 2004.
Auf der Suche nach einem "Narrativ"
Ob Bürger "ihren" Staat als Einwanderungsland begreifen, sieht man nicht nur daran, wie sie mit Arbeitsmigration umgehen. Ein Einwanderungsland entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Es hat eine Geschichte. Eine Geschichte, die immer wieder erzählt werden muss, damit sie im kollektiven Gedächtnis ankommt. Obwohl die Historikerinnen Hintermann und Johansson in ihrer Forschung bis in
die 60er-Jahre zurückblicken, finden sie erst in den 90ern Anzeichen dafür, dass Migration und Integration in Schulbüchern und Museen thematisiert wird.
Wenn Geschichte aufgearbeitet wird, geht es immer darum, wer sich wessen wie erinnert. Das ist besonders heikel bei Schulbüchern, weil sie – mehr noch als Museen – hegemoniales Wissen abbilden. Christiane Hintermann hat österreichische Geschichts- und Geografiebücher untersucht und kommt zu dem Resümee, dass Migrations- und Integrationsthemen nach wie vor keine große Rolle spielen.
Und wenn doch – dann ist es immer noch ein "Reden über", ein "Wir und die anderen", das die geschichtliche Aufarbeitung von Migration prägt. Das Ganze bekommt einen paradoxen Touch, wenn man sich vorstellt, wie Lehrer vor manchen Klassen von "den anderen" sprechen, obwohl die Hälfte der Schüler ausländische Wurzeln hat.
"Migration and Memory" und "Debating Migration" sind weit davon entfernt, populärwissenschaftliche, flott geschriebene Bücher zu sein. Sie erklären einem nicht das große Ganze, streicheln weder die Schweden, noch schlagen sie auf die verzögerte Politik der Österreicher hin. Stattdessen präsentieren die Wissenschaftler Fallstudien über österreichische Ausstellungen oder skizzieren die Debatte über qualifizierte Arbeitskräfte. Das geht natürlich nicht so leicht runter wie die saloppen Ansagen von Sebastian Kurz.
Am Ende beantworten die Bücher dennoch die Frage, warum Österreich erst seit zwei Wochen ein Staatssekretariat für Integration hat und warum es ein 24-jähriger Jusstudent leitet: Österreich beginnt erst langsam, sich als Einwanderungsland
zu begreifen.