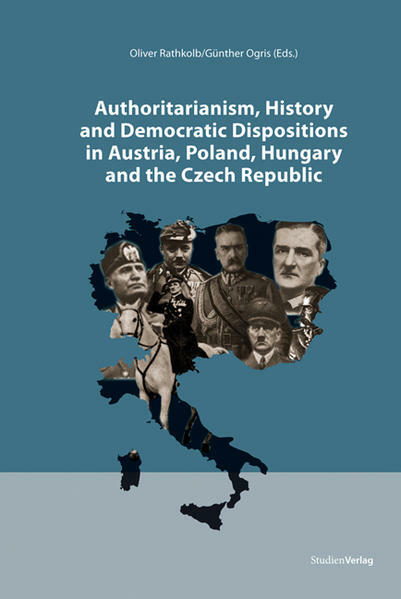Es wächst zusammen, was lange nicht zusammen war
Anton Pelinka in FALTER 31/2010 vom 04.08.2010 (S. 17)
Vier Länder, viertausend Interviews: eine Studie über Autoritarismus in Österreich, Ungarn, der Tschechischen Republik und Polen
Das Buch vereint viele Ansätze und Ebenen: die Ergebnisse einer in den vier Staaten durchgeführten Umfrage; ein anspruchsvolles Design zum Thema Autoritarismus und "group-related Misanthropy", also negative Stereotypisierungen; und interessante Hypothesen über die seit der klassischen Studie von Theodor Adorno und anderen bekannten Zusammenhänge zwischen individueller Xenophobie und Rassismus auf der einen und politischem Autoritarismus auf der anderen Seite.
Das Korsett des Buches sind die Interviews, die mit jeweils 1000 Personen in den vier Ländern geführt wurden. Was die allgemeine Autoritarismusneigung betrifft, so müssen die Erkenntnisse Adornos und der anderen jedenfalls nicht neu geschrieben werden. Was besonders ist, das ist die Verbindung zur jüngsten Geschichte der vier Staaten: Die Freiheit, die solche Befragungen überhaupt erst ermöglicht, wird nicht ohne Einschränkungen geschätzt. Es gibt so etwas wie Nostalgie für das alte System: In Ungarn erklärten bei der Repräsentativbefragung 2007 nur 36 Prozent der Frauen und 44 Prozent der Männer, dass das "neue", 1989/90 entstandene System "besser" sei (S. 131). Die Zustimmung zur Transformation ist zwar in Polen und der Tschechischen Republik deutlich höher, aber insgesamt ergibt sich ein sehr komplexes Bild, das jedenfalls nicht dem eines geschlossenen Auszugs versklavter Völker aus dem sowjetischen Kerker entspricht.
Diese Nostalgie nimmt nicht die Formen an, die einen politisch signifikanten Wunsch nach der Wiederkehr des kommunistischen Systems zum Ausdruck brächten. Aber die persönliche Wahrnehmung, zu den ökonomischen Verlierern der Transformation zu gehören, und die Schwierigkeiten, mit einer durch scharfen Wettbewerb gekennzeichneten Ordnung zurechtzukommen, schaffen so etwas wie eine stille Sehnsucht nach dem kommunistischen Biedermeier à la Kadar und Hussak.
Und wie kommt Österreich in das Bild – Österreich als der einzige nach allen einschlägigen Kategorien zu Zentraleuropa zu zählende Staat, der zwar durch die Phase eines rechten Totalitarismus zu gehen hatte, dem aber eine Diktatur sowjetischen Vorzeichens erspart blieb? Die Erhebung hat in Österreich nach der Wahrnehmung der Ereignisse von 1989 gefragt. 48 Prozent der Befragten in Österreich erklärten, die Öffnung der Grenzen 1989 wäre ein Vorteil für Österreich gewesen (S. 131 f.). Immerhin – oder nur 48 Prozent? Und noch etwas: Österreich, das Land, in dem so viele Menschen mit slawischen Wurzeln leben, reiht unter seinen Nachbarn die Slawen deutlich unterhalb der anderen (hier konkret: der Ungarn) ein. Das aus Unsicherheit und Überanpassung gespeiste antislawische Vorurteil lebt.
Das Buch arbeitet sehr gut heraus, welche Parallelen der Vergangenheitsdiskurs in allen Staaten aufweist: Viktimisierung ("wir sind immer nur Opfer"), Heroisierung ("wir haben uns selbst befreit") und eine Tendenz zum "Schlussstrich" ("einmal muss es doch mit der ewigen Selbstkritik ein Ende haben") finden sich, natürlich mit unterschiedlichen Akzenten und unterschiedlicher Intensität, in allen diesen Staaten. Das polnische Beispiel – die erst vor wenigen Jahren einsetzende Debatte über die Rolle des polnischen Antisemitismus im (von deutschen Autoritäten zu verantwortenden) Holocaust – mag da für eine grundsätzliche Neigung stehen: Die von (links-)liberalen Eliten vorangetriebene Debatte provoziert Widerstand, sichert aber dennoch einen Diskurs, der nicht mehr zurückgenommen werden kann (S. 63–65).
Dieser Widerstand richtet sich dagegen, dass herrschende Narrative hinterfragt werden. Er ist Ausdruck einer Verunsicherung: Man glaubte doch zu wissen, wie "es", die eigene Geschichte "wirklich" war; und nun wird man damit konfrontiert, dass die Wirklichkeit komplexer und widersprüchlicher war und ist als das, woran zu glauben man sich gewöhnt hat: an die eigene kollektive Unschuld, an die eigene Opferrolle. Auch wenn die konkreten Narrative, die dekonstruiert werden, in den einzelnen Staaten höchst widersprüchlich, ja gegenläufig sind: Es bleibt das gemeinsame Unbehagen.
Noch zum Thema Holocaust: Die Antworten in Österreich zeigen die vergleichsweise größte Bereitschaft, eine nationale Mitverantwortung zuzugestehen – und den Holocaust insgesamt als eine besondere "negative Erinnerung" einzustufen (S. 117, 138). Wie immer das auch zu interpretieren ist – dieses Ergebnis lässt jedenfalls die Erklärung zu, dass eine entsprechende Schwerpunktsetzung im Bildungssystem erhebliche Wirkung zeigt. Mit anderen Worten: Politische Bildung macht sich bezahlt. Denn in den drei anderen Staaten war ja bis 1990 der Holocaust ein Unterunterkapitel einer von nationalen und kommunistischen Mythen beherrschten Geschichtsschreibung. Und politische Bildung in dem Sinn, wie sie – vom Anspruch her – in Österreich verstanden wird, konnte daher auch erst später einsetzen.
Was insgesamt aber hervorsticht: Die Differenzen innerhalb der Gesellschaften der vier Staaten erweisen sich tendenziell jedenfalls stärker als zwischen diesen Staaten. Es wächst – um mit Willy Brandt zu sprechen – zusammen, was zusammengehört. Dazu bedarf es keiner Habsburgsehnsucht und keiner Verklärung des
19. Jahrhunderts (was jedenfalls im Fall
Polens ohnehin nur absurd wäre). Es genügt die Erkenntnis, dass die Autoritarismusforschung Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA Annahmen vorgegeben hat, die in Zentraleuropa am Beginn des 21. Jahrhunderts sich grosso modo bestätigen: Die Freiheit ist zwar allen zumutbar, sie wird aber nicht von allen gleichermaßen geschätzt; wohl auch deshalb, weil sie nicht von allen gleichermaßen genützt werden kann.