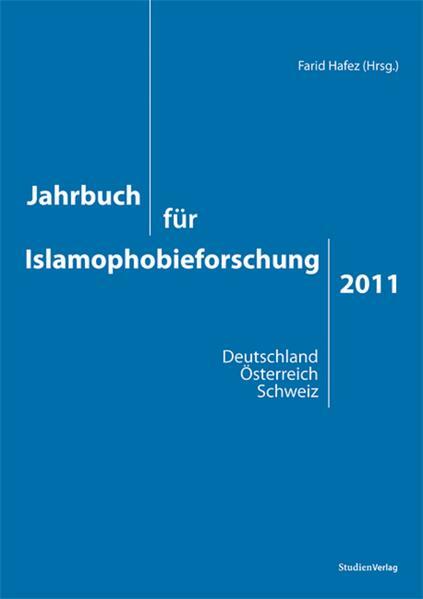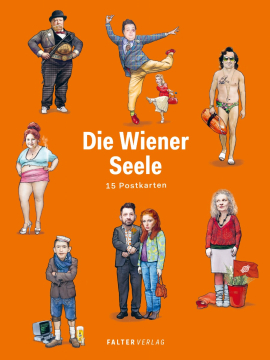Wenn das Feindbild Islam die Schlagzeilen dominiert
Marion Bacher in FALTER 23/2011 vom 08.06.2011 (S. 21)
Das Jahrbuch für Islamophobieforschung 2011 stellt auch den Qualitätsmedien ein vernichtendes Zeugnis aus
Nachdem Josef Pröll im April seinen Rücktritt bekanntgab, hievte
Profil H.-C. Strache aufs Cover. Das Nachrichtenmagazin titelte "Pröll geht, Strache kommt". Die gleiche Partei, die Profil als Siegerin herbeischrieb, fiel im Wiener Wahlkampf mit islamophober Propaganda auf. Ob mit der Diskreditierung der SPÖ als "Islamistenpartei", mit Wortneuschöpfungen wie "Gegengesellschaft" oder mit indirekten Aufrufen zur Gewalt gegen Muslime in ihrem Comic "Sagen aus Wien" – die antimuslimische Hetze der FPÖ hatte im September 2010 eine neue Dimension erreicht.
Mit genau diesen Diskursstrategien beschäftigt sich Farid Hafez im "Jahrbuch für Islamophobieforschung 2011". Der Politikwissenschaftler ist Herausgeber des Sammelbandes, in dem sich sieben Autoren mit islamfeindlichen Tendenzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auseinandersetzen.
Historische Aufsätze über das "Feindbild Islam" in neurechten Periodika vor 9/11 werden dort genauso publiziert wie die Auseinandersetzung mit Judith Butlers Kritik an der Instrumentalisierung von Bi- oder Homosexuellen, Transsexuellen und Queers gegen die Zuwanderung von Muslimen. Besondere Aufmerksamkeit schenken die Studienautoren jedoch den Medien, die eine wesentliche Rolle in der Konstruktion und Wiedergabe von Diskursen spielen.
Astrid Mattes setzt sich beispielsweise mit der Berichterstattung österreichischer Medien über das Schweizer Minarettverbot auseinander und kommt zu dem Resümee, dass in allen zwölf untersuchten Publikationen – von der Kronen Zeitung bis Profil – islamophobe Muster "stark" vertreten sind. Mit Argumenten wie "Muslime brauchen keine Minarette zur freien Religionsausübung", "in muslimischen Ländern werden Christen auch unterdrückt" oder "Minarette passen nicht zur europäischen, christlichen Kultur" versuchten Journalisten und Leser das Minarettverbot zu legitimieren. Die Gleichstellung von Leitartikeln und Leserbriefen in Mattes Analyse muss jedoch hinterfragt werden.
Nicht diskursanalytisch, sondern auf sprachlicher Ebene untersucht Abdel-Hafiez Massud zwei Artikel aus dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die kurze Zeit nach den terroristischen Anschlägen in Madrid im März 2004 erschienen sind. "Sämtliche Symbole der Religion des Islams wie der Koran, die Moschee, die Muslime werden ad absurdum geführt und als Symbole einer Terrorbewegung restlos degradiert", schreibt Massud. Sein Fazit: Selbst der renommierte Spiegel reproduziert den vorhandenen Diskurs in der Gesellschaft nur und versucht in keiner Weise, zu differenzieren oder gar aufzuklären.
Obwohl die letztgenannten Studien interessante Ergebnisse liefern, zeigen sich gerade bei ihnen die Grenzen qualitativer Sozialforschung – lediglich für das untersuchte Material können die Autoren verlässliche Aussagen treffen. Quantitative Studien fehlen hingegen in dem Sammelband. Auch gibt es keinen Beitrag von der "anderen" Seite – wie etwa gehen Betroffene mit Islamophobie um? Und mit einem Beirat aus renommierten Wissenschaftlern aus Berlin, Wien und Fribourg würden sich auch transnationale Analysen und Vergleichsstudien anbieten.
Dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft wurde, zeigt nur, wie viele Aspekte der Islamophobie dem derzeitigen Forschungsstand noch offenstehen.