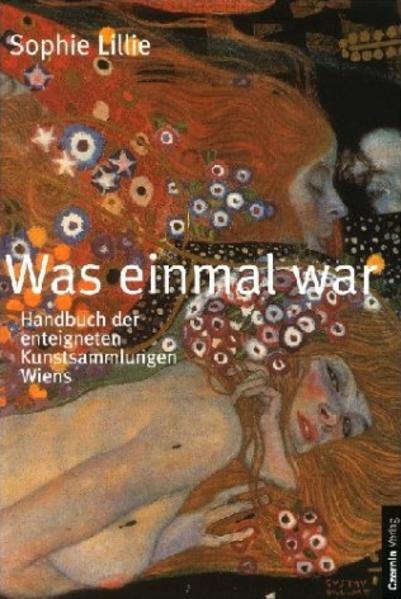Gabriele Anderl in FALTER 49/2003 vom 03.12.2003 (S. 16)
Ein neues Buch dokumentiert, wie sich Museen, Kunsthandel und Einzelne an jüdischen Sammlungen bereicherten. Besonders erfolgreich dabei war der Wiener Schätzmeister Anton Exner.
Er hatte Dutzende Reisen nach China und Japan unternommen, war Eigentümer eines Fachgeschäfts für ostasiatische Kunst in Wien, ein besessener Sammler und wegen seiner Spezialkenntnisse zugleich Schätzmeister am Dorotheum: Anton Exner. Bis 1944 taucht sein Name im Zusammenhang mit fast allen großen Auktionen auf, bei denen auch Ostasiatika versteigert wurden. Die 474. Kunstauktion vom 31. März 1941, bei der ausschließlich chinesische und japanische Kunstgegenstände von hoher Qualität aus den Beständen einer Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen - nicht namentlich genannten - Sammlung unter den Hammer kamen, stellte dabei keine Ausnahme dar. Vieles spricht dafür, dass es sich um eine Sammlung aus jüdischem Besitz gehandelt hat.
An mehreren Stellen findet sich Exners Name auch in dem eben erschienenen Buch von Sophie Lillie, in dem es, wie schon der Titel - "Was einmal war" - besagt, um Verlorenes geht: um die jüdischen Kunstsammlungen, die nach 1938 zerschlagen und ihren Besitzern entzogen worden sind, während diese flüchten mussten oder ermordet wurden. Rund 150 dieser Sammlungen hat die Kunsthistorikerin in akribischer Arbeit rekonstruiert. Das Buch besteht aus umfangreichen Inventarlisten, denen knappe und dennoch berührende Einleitungstexte zu den Biografien der Eigentümer und dem Schicksal der jeweiligen Sammlungen vorangestellt sind.
Der "Fall Exner" ist nur einer von vielen, die sich auf Basis dieses Buches weiter verfolgen lässt. Er beweist, dass auch für die Provenienzforschung in den Museen - trotz ihrer unbestreitbaren Verdienste - noch viel an Arbeit zu leisten bleibt.
Eine der von Lillie porträtierten Sammlungen ist etwa die von Hans Amon. Dieser hatte eine auf Kunst und Kultur Ostasiens spezialisierte Buchhandlung im so genannten "Hochhaus" Herrengasse/Wallnerstraße/Fahnengasse im ersten Bezirk sowie eine bemerkenswerte Asiatika-Sammlung besessen. Hans Amon und Anton Exner teilten somit die Leidenschaft für erlesene Kunst aus Fernost. Es ist denkbar, ja sogar wahrscheinlich, dass sie einander gekannt haben.
Am 12. Februar 1939 machte Exner an die unter anderem für die Genehmigungen zur Ausfuhr von Kunst- und Kulturgütern zuständige "Zentralstelle für Denkmalschutz" (heute Bundesdenkmalamt) eine Mitteilung "in Angelegenheit des Juden Hans Amon": "Im Besitze des Amon", erklärte Exner, befinde sich "eine Anzahl wertvoller japanischer Drucke, an denen die Kunstsammlungen der Ostmark besonders arm sind. Drucke dieser Art werden von allen Museen der Welt für die Kunsterforschung für sehr wichtig gehalten und derart gesammelt, dass im Welthandel fast nichts mehr dieser Art vorhanden ist. Es wäre daher ein nicht wieder gut zu machender Schaden, der gesamten Sammlung die Ausfuhrerlaubnis zu erteilen. Unsere Albertina besitzt an ostasiatischen Beständen fast gar nichts Gutes und ich empfehle, das wertvollere Kunstgut der Sammlung Amon diesem Institut zu erhalten." Exner drängte die Behörde, "die auf diese Gegenstände bereits erteilte Ausfuhrerlaubnis aufzuheben".
Im Fall Amon kam Exner - zumindest beim Denkmalamt - zu spät. Denn wie aus einem Aktenvermerk dieser Behörde hervorgeht, befand sich die Sammlung bereits außer Landes.
Mehr Glück hatte Exner im Fall von Klara Steiner, die wie ihre Mutter Jenny eine beachtliche Kunstsammlung, vor allem auch kostbare Ostasiatika, besaß. Ein Teil der Sammlung wurde nach 1938 beschlagnahmt und Anfang Jänner 1940 im Dorotheum versteigert. Die nach Kriegsende von Steiner betriebenen Nachforschungen ergaben, dass mehrere Gegenstände offenbar von Exner bzw. dessen Tochter erworben worden waren. Über den Verbleib konnten oder wollten die Letztgenannten aber keine Auskunft erteilen. Von ihren in Verlust geratenen Schätzen konnte Steiner nur ein einziges Objekt ausfindig machen: eine exquisite, aus der Zeit um 1200 stammende chinesische Holzstatue des Bodhisattva, die im Dorotheum versteigert worden war. Die Besitzerin stiftete die Anfang der 1950er-Jahre restituierte Statue 1970 dem Metropolitan Museum of Art in ihrer neuen Heimatstadt New York.
Am 23. Dezember 1958 hatte die Zeitung Neues Österreich unter dem Titel "Arisierte Grabfiguren in der Museumsvitrine" über den Rückstellungsprozess eines während der NS-Zeit aus Wien vertriebenen Ehepaares "C." (es handelte sich um den Textilindustriellen Edwin Czeczowiczka und dessen Frau Caroline) gegen die Republik Österreich berichtet. Unter anderem ging es dabei um "zwei chinesische Grabfiguren von hohem musealem Wert" - eine Prinzessin aus der Tang-Zeit und zwei Pferde aus der Wie-Periode -, die "auf eigenartigen Umwegen in das Museum für angewandte Kunst (MAK) gelangt" waren. Die Umwege hatten über Anton Exner geführt: Der bei der Verhandlung als Zeuge einvernommene Kunsthändler Förster gab zu Protokoll, er habe die Figuren 1927 aus China importiert und an das Ehepaar verkauft. Fast während der gesamten NS-Zeit sei Exner der einzige Experte für ostasiatische Kunst gewesen und habe im Rahmen seiner Tätigkeit für die Vermögensverkehrsstelle (die zentrale "Arisierungsbehörde" in Wien) Kunstgegenstände aus jüdischem Besitz zu seinen eigenen Schätzpreisen angekauft. Exner hatte in dieser Zeit die Errichtung eines Asienmuseums in Wien auf Basis seiner eigenen Sammlung geplant: "In seinem Fanatismus für dieses Werk ging er so weit, dass er beispielsweise jüdisches Transportgut, das bereits den Emigranten zur Verschiffung nach Hamburg nachgeschickt worden war, zurückbeorderte, weil er erfahren hatte, dass dieser Lift' einen Kunstgegenstand enthielt, der ihm für eine Serie fehlte. So kam der ganze Transport zurück, der Krieg brach aus, und die Eigentümer im Ausland waren um ihr Hab und Gut gekommen", berichtete Förster. Exner habe auch die beiden Keramiken aus dem Besitz Czeczowiczka für dieses Projekt zurückbehalten; sie seien nach dem Krieg mit anderen Kunstgegenständen aus der Sammlung Exner dem MAK vermacht worden.
Obwohl das im Ausland lebende Ehepaar Czeczowiczka bereits 1945 dem Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Wiens, Alfred Stix, sowie dem Denkmalamt eine Suchliste der ihnen geraubten Objekte übergeben hatte, hatte das MAK die Figuren übernommen. Die Finanzprokuratur, die im Rückstellungsprozess das MAK vertrat, verteidigte die Transaktion als "redlichen und gutgläubigen" Erwerb, doch die beiden Objekte wurden restituiert.
Dasselbe gilt für einen Teil der zahllosen anderen Kunstobjekte aus den von Lillie rekonstruierten Sammlungen. Ein großer Teil bleibt freilich bis heute unauffindbar. Vor allem in den zahlreichen Fällen, in denen die Wertgegenstände über Auktionshäuser und den Kunsthandel an Privatpersonen veräußert wurden, verloren sich die Spuren besonders rasch - zählt doch in dieser Branche Diskretion zu den Grundregeln des Geschäfts.
Während das Ehepaar Czeczowiczka, Hans Amon, Klara Steiner und viele andere jüdische Sammler heute weitgehend vergessen sind, ist es Anton Exner und seinem dieser Tage 92-jährig verstorbenen Sohn Walter gelungen, sich als Spender wertvoller ostasiatischer Kunst an Wiener Museen - vor allem an das MAK - zu verewigen. In einer 1982 zu Anton Exners hundertstem Geburtstag herausgegebenen Gedenkschrift würdigte der damalige Direktor des MAK, Herbert Fux, den 1952 Verstorbenen mit überschwänglichen Worten. Das Haus am Stubenring verdanke ihm die größte Schenkung in seiner über hundertjährigen Geschichte - rund "3000 Objekte hervorragender Qualität", eine "Größenordnung", die sich "in einer einzigen Ausstellung nicht mehr präsentieren lässt, weil damit die Grenzen des Überschaubaren überschritten würden".
Auch mit den Leitungsmitgliedern des Völkerkundemuseums hatte Exner jahrzehntelang regen Kontakt gepflegt. Das Haus hatte von ihm zwischen 1928 und 1952 rund tausend Leihgaben für Ausstellungen, aber auch zahlreiche Schenkungen erhalten - einen beträchtlichen Teil davon in den Jahren 1938 bis 1943.
Anton Exner war bereits seit 1931 NSDAP-Mitglied gewesen. Gemäß staatspolizeilicher Erhebungen war er ein "radikaler Nationalsozialist", der sich "besonders antisemitisch betätigt" hatte. In einem 1938 ausgefüllten Personalfragebogen der NSDAP hatte Exner betont, dass sein Haus in der Verbotszeit "eine Zufluchtsstelle für verfolgte, hilfsbedürftige Parteigenossen gewesen" war, sich dort eine geheime Druckerei befunden und sein Sohn Munition versteckt hatte. Er habe "in der Hauptanstalt des Dorotheums" für die NSDAP geworben und sogar auf seinen Weltreisen unter Gefahr für Freiheit und Leben "für den Nationalsozialismus und Deutschlands Ehre" gekämpft.
Die politische Vergangenheit des edlen Spenders wurde in der Gedenkschrift zu dessen hundertsten Geburtstag, die übrigens vom Wissenschaftsministerium herausgegeben wurde, mit keinem Wort erwähnt.