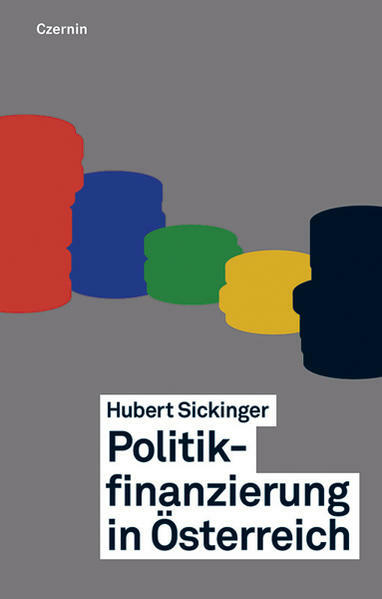Auf der Jagd nach den verborgenen Parteispenden
Martin Zorn in FALTER 9/2010 vom 03.03.2010 (S. 15)
Hubert Sickinger hat die Finanzen der österreichischen Politik durchforstet. Es wird getrickst, getäuscht und getarnt
Anfang Jänner, auf dem Höhepunkt des Hypo-Skandals, hat Hubert Sickinger eine Reform der Parteienfinanzierung gefordert, wie er das regelmäßig tut. Die Abfuhr kam prompt: ÖVP-Generalsekretär Fritz Kaltenegger genügten "Wählervotum und öffentliche Meinung" als Kontrolle und Sanktion für Parteispenden. Eine Erklärung, wie der Wähler vor ihm geheim gehaltene Parteispenden kontrollieren soll, blieb Kaltenegger schuldig. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter sah keinen Grund, "aus einem Anlassfall heraus" strengere Regeln einzuführen. Sickingers Argumente seien "nicht sattelfest".
So kaltschnäuzig und unverschämt diese Stellungnahmen auch sind – nachdem man Hubert Sickingers Buch "Politikfinanzierung" gelesen hat, kann man die Generalsekretäre verstehen. Die Parteien verfolgen in diesem Bereich ihre unmittelbaren eigenen Interessen, sie sprechen das Thema kaum in der Öffentlichkeit an, und abseits der Aufdeckung von Skandalen beschäftigen sich auch Medien nur selten damit. Da nervt ein Wissenschaftler gewaltig, der unangenehme Wahrheiten öffentlich ausspricht.
Es gibt kaum Staaten, die politische Parteien mit mehr Geld fördern als Österreich (28 Euro pro Wahlberechtigten waren es im Jahr 2009). Zugleich gibt es kaum Staaten, die Parteispenden so lax kontrollieren wie Österreich. Parteinahe Wirtschaftsprüfer prüfen und bestätigen, dass die Spenden widmungsgemäß verwendet wurden. In der Wiener Zeitung erscheint dann jährlich ein Rechenschaftsbericht und eine Liste, in der zwar die Höhe der Spenden aufscheint, die Namen der Spender aber fehlen. Der Präsident des Rechnungshofs erhält als Einziger auch die Namen der Spender, muss sie aber geheim halten – außer er wird von einer Partei gebeten, öffentlich zu bestätigen, dass ihm eine Spende ordnungsgemäß gemeldet wurde. Das soll "in kritischen Fällen eine gewisse Kontrollmöglichkeit" bieten. Doch es wundert nicht, dass es zwischen 1985 und 2009 kein einziges Mal dazu gekommen ist. Strafen für falsche oder unvollständige Meldungen gibt es keine.
International geht der Trend in eine völlig andere Richtung: Bereits 2003 hat der Europarat empfohlen, die Veröffentlichung von Parteispenden ab einer bestimmten Höhe vorzuschreiben und sicherzustellen, dass diese Grenzwerte nicht umgangen werden. Spenden von Unternehmen sollen in Geschäftsbüchern ersichtlich sein und den Aktionären bekanntgemacht werden. Unternehmen, die öffentliche Aufträge erhalten, und Geldgeber im Ausland sollen besonders restriktiven Regeln unterworfen werden. Und Unternehmen, die vom Staat beherrscht werden, sollen Parteien überhaupt nichts spenden dürfen. Keine dieser Empfehlungen wird in Österreich derzeit eingehalten. Wie beim Bankgeheimnis halten die Parteien an ihren liebgewonnenen und für sie äußerst praktischen Regeln fest. 2010 oder 2011 wird Österreich vom Europarat überprüft werden. Sickinger weist darauf hin, dass ein äußerst negatives Ergebnis zu erwarten ist. Das dürfte den Parteien aber keine schlaflosen Nächte bereiten.
Großspenden von Unternehmen sind für Sickinger besonders problematisch: Nur in Extremfällen sind sie strafrechtlich verboten, wenn der Spender unmittelbar eine politische Entscheidung kauft oder gezwungen wird, "Schutzgeld" für gewünschtes Verhalten zu zahlen (z.B. einen öffentlichen Auftrag). Viel häufiger geht es Unternehmen um "politische Landschaftspflege", um das Schaffen eines für sie günstigen politischen Klimas und um Zugang zu Entscheidungsträgern in kritischen Situationen. Dieser Kauf von politischem Einfluss kann für den Bürger nur sichtbar gemacht werden, indem Informationen zu Spenden verpflichtend veröffentlicht werden.
Aus dem internationalen Vergleich ergibt sich klar, was Österreich tun müsste, um internationalen Anforderungen zu genügen: Es braucht eine klare Regel, dass Spenden an Parteien und Politiker über einem bestimmten Betrag zu veröffentlichen sind. Diese Regel muss für die Parteien, aber auch für Spenden an "Vorfeldorganisationen", Landes- und Bezirksparteiorganisationen und direkt an Politiker (wie bei der "Grasser-Homepage") gelten und muss so formuliert sein, dass sie nicht ohne weiteres umgangen werden kann. Ihre Einhaltung muss von einer politisch unabhängigen Regulierungsbehörde untersucht werden, die wirksame Ermittlungen führen kann, bei Verstößen spürbare Strafen verhängt (etwa durch Kürzung staatlicher Förderungen) und auch den Auftrag hat, die öffentliche Debatte zur Politikfinanzierung zu unterstützen. Sickinger kann sich den Rechnungshof als Kontrollorgan vorstellen. Ein weiterer wichtiger Schritt wäre eine Beschränkung der Wahlkampfkosten.
Ob eine solche Reform jemals kommt, ist jedoch äußerst ungewiss. In der Vergangenheit wurde das Thema Parteienfinanzierung immer nur als taktisches Spielmaterial verwendet: Man fordert eine Reform, von der man sich bei der nächsten anstehenden Wahl unmittelbaren Nutzen erhofft, oder man verlangt Änderungen, von denen man weiß, dass die anderen Parteien sie ablehnen und sie daher nicht beschlossen werden. Jüngstes Beispiel: die Forderung des ÖVP-Generalsekretärs Kaltenegger, erst mit der SPÖ über eine Reform zu verhandeln, wenn die steirische SPÖ 300 Millionen Euro zahlt, die sie über Stiftungskonstruktionen eingespart hat.
Hubert Sickinger wird wohl noch lange Reformen fördern müssen. Mit seinem Buch hat er jedenfalls eine präzise und umfassende Analyse der Finanzierung der Politik in Österreich vorgelegt. Die Fakten und viele durchdachte Vorschläge zu Reformen liegen auf dem Tisch. Es braucht nur mehr die Bereitschaft, sich von liebgewonnenen Gewohnheiten zu verabschieden.
Der österreichische Schein
Florian Klenk in FALTER 4/2010 vom 27.01.2010 (S. 14)
Eurofighter, Buwog, Hypo, Scheuch: Warum haben Staatsanwälte bei Provisionszahlungen und Parteispenden das Nachsehen? Ein Gespräch mit dem Korruptionsforscher Hubert Sickinger
Die Buberlpartie Haiders und seine Vertrauten wurden reich. Sechs Millionen Euro nahm etwa Ex-FPÖ-General Gernot Rumpold als Lobbyist für den Eurofighter, für eine Pressekonferenz verrechnete er 90.000 Euro. Rund sieben Millionen steckte sein ehemaliger Parteifreund Walter Meischberger als Provision beim Buwog-Deal ein, allerdings unversteuert. Der Kärntner Steuerberater Dietrich Birnbacher wiederum, ein Vertrauter Haiders und der Kärntner ÖVP, kassierte sechs Millionen für ein mündliches Gutachten im Fall Hypo. Ganz legal, wie die Justiz attestierte. Der Banker Tilo Berlin und seine Investoren hatten derweil mehr als das 20-Fache beim Verkauf der Pleitebank verdient.
Und nun ist da noch dieses Tonband aus Kärnten. Uwe Scheuch, berichtet News, soll von russischen Investoren Parteispenden gefordert haben – und diesen im Gegenzug den österreichischen Pass in Aussicht gestellt haben. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt.
Warum haben Staatsanwälte in solchen Fällen oft das Nachsehen? Der Politologe Hubert Sickinger brachte im Czernin-Verlag kürzlich das Buch "Politikfinanzierung in Österreich" heraus. Er fordert grundlegende Reformen nach deutschem Vorbild.
Falter: Herr Sickinger, fast jede Woche werden neue Skandale enthüllt. Was lernen wir aus den Affären?
Hubert Sickinger: Die "Privatisierungsgewinne" und Provisionen im Fall Hypo liegen in astronomischen Höhen. Der Fall Uwe Scheuch hat deshalb eine neue Qualität, weil ein Politiker laut Medienberichten ganz offen hohe Parteispenden für eine Staatsbürgerschaft einforderte und dies erstmals dokumentiert ist. Bisher konnte man solche Sitten nur vermuten – etwa im Zusammenhang mit der Klagenfurter Stadionaffäre. Nun hat die Staatsanwaltschaft genaue Anhaltspunkte, um rigoros zu prüfen.
Die Politiker scheinen die Vorwürfe auszusitzen. Die Öffentlichkeit wendet sich von den Fällen bald wieder ab.
Sickinger: Man muss den Österreichern klarmachen, dass hier mutmaßlich Kickbacks auf Kosten der Allgemeinheit gezahlt werden. Die Projekte, über die Scheuch laut News mit den Russen sprach, sind offenbar durchwegs vom Land hoch subventioniert und zugleich Projekte, deren Rentabilität stark umstritten ist. Dazu kommt, dass die Staatsbürgerschaft bei Nicht-EU-Staatsbürgern aus Osteuropa sehr begehrt ist, da sie die Türen in den ganzen EU-Raum und die Schweiz öffnet. Das ist auch ein europäisches kriminalpolitisches Problem.
Warum müssen Staatsanwälte zusehen, wie fette Provisionen über parteinahe Werbeagenturen verteilt werden ?
Sickinger: Die Strafverfolgung scheitert meistens an der Beweisfrage. Ankläger müssen nachweisen, dass Zahlungen in direktem Austausch für staatliche Entscheidungen geflossen sind. Das ist unheimlich schwer.
Was muss geschehen?
Sickinger: Das System könnte durch öffentliche Rechenschaftspflichten der Parteien bekämpft werden: Korruptionsverdächtige Spenden an Parteien und Politiker müssen offengelegt werden. Die Parteien müssen ihre Finanzen von wirklich unabhängigen Stellen prüfen lassen. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass deren Angaben "eh richtig" sind. Die derzeitige Regelung – sie gilt unverändert seit einem Vierteljahrhundert – ist typisch österreichischer Schein: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob es Regelungen für Spenden gäbe. Erst genaues Hinsehen zeigt, dass in Wirklichkeit keine Transparenz besteht. Wenn die Parteien die Regeln trotzdem ignorieren, gibt es nicht einmal Sanktionen.
Machen es andere Länder anders?
Sickinger: Bei der Rechenschaftspflicht der Parteien ist Deutschland vorbildlich. Spenden sind ab 10.000 Euro zu veröffentlichen, Zuwendungen durch Stückelung zu verschleiern ist verboten, und ab 50.000 Euro sind Spenden "zeitnah" zu veröffentlichen. Sie können auf der Bundestagshomepage nachlesen, wer welche Parteien großzügig unterstützt – und dann ergründen, ob die Spender privilegiert behandelt werden. In Deutschland wird normalerweise der dreifache Betrag einer "verschwiegenen" Spende als Strafzahlung fällig. Die Verantwortlichen machen sich strafbar, wenn sie das Regelwerk bewusst missachten.
Welche konkreten Reformen schlagen Sie also vor?
Sickinger: Ich denke, dass Parteien Spenden ab einer gewissen Höhe veröffentlichen müssen – und zwar nicht nur die Bundesparteien, sondern auch die Landes- und Regionalorganisationen. Auch die Bünde und Verbände, etwa der Bauernbund oder die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter. Wir müssen über Rahmenbedingungen für das Mäzenatentum reden. Manchmal ist es ja so, dass ein Unternehmen Geld in eine wohltätige Stiftung einzahlt, ein Politiker damit aber nur Projekte umsetzt, um sich in deren Erfolg zu sonnen. Ich verweise hier auf die Kärnten-Stiftung oder etwa die Erwin-Pröll-Privatstiftung. Diese Stiftungen sind nicht transparent. All das ist ein Einfallstor für Korruption. Wir brauchen strengere Regeln.
Wie können die aussehen?
Sickinger: Man müsste zum Beispiel untersuchen, wie viele Plakate und Inserate eine Partei schaltet – und wie viel sie dafür wirklich bezahlt. Anscheinend verrechnen manche parteinahe Agenturen ihren Parteien nur einen Teil der Kosten. Wer zahlt den Rest? Wessen Gelder erstatten die Agenturen ihren Parteien auf diesem Wege zurück?
Warum wehren sich unsere Parteien so gegen mehr Kontrolle?
Sickinger: Sie müssten wohl einige sprudelnde Geldquellen stilllegen. Die Parteichefs ahnen, dass es Leichen im Keller gibt. Zweites Problem: Die Bundesparteien haben keinen Einblick in die Finanzen der Landesparteien. Die Landesparteien würden sich auch heftig dagegen wehren. Über Geld zu verfügen, das bedeutet nämlich auch innerparteilich Macht. Drittes Problem: Viele Spender wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen, manche fürchten auch das Repressionspotenzial jener Partei, der sie nicht spenden. Die Wähler aber sollten sich das System nicht gefallenlassen. Sie finanzieren die Parteien mit Steuern. Doch diesen Zuwendungen steht keine staatliche Kontrolle gegenüber.