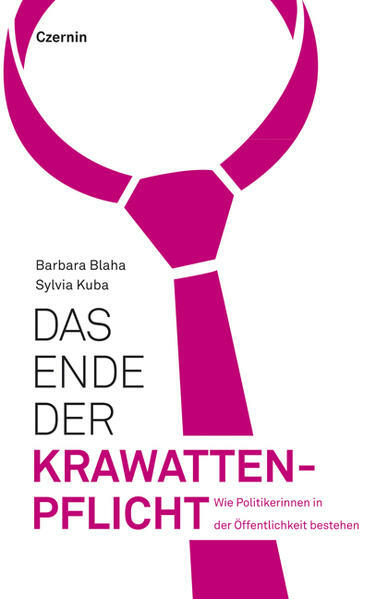Eine "Man's World", die vielleicht bald von gestern ist
Nina Horaczek in FALTER 10/2012 vom 07.03.2012 (S. 19)
Würden alle Frauen in Österreich an einem einzigen Tag, zum Beispiel am 8. März, dem Weltfrauentag, streiken, würde sich ganz oben wenig tun. Zwar könnten Schulen, Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser, Supermärkte gar nicht erst aufsperren, in der Politik hingegen würde sich so ein Streik kaum stärker auswirken als eine durchschnittliche Grippewelle. In der Bundesregierung wäre ein kleines Loch auszumachen, im Wiener Rathaus würde dem Bürgermeister der Vize fehlen, aber in den Ebenen darunter gäbe es business as usual.
Und das, obwohl in Österreich mehr Frauen als Männer leben. 4.301.308 Österreicherinnen zu 4.086.434 Österreichern war der Stand im Jahr 2010, sagt die Statistik Austria. Warum regieren dann trotzdem die Männer? Wieso beträgt der Frauenanteil im Parlament fast 100 Jahre nach Erkämpfung des Frauenwahlrechts nur 27,32 Prozent? Warum kommen hierzulande auf 2238 männliche Bürgermeister nur 119 weibliche? Wieso überlassen Frauen das Gestalten der Macht – denn nichts anderes ist Politik – immer noch den Männern?
Wissenschaft und Oscarvergabe
Mit diesen Fragen beschäftigen sich Barbara Blaha und Sylvia Kuba. Beide kennen das politische Parkett auch aus der Praxis. Die Germanistin Blaha war bis 2007 Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft und gründete ein Jahr später den politischen Kongress Momentum, der jährlich in Hallstatt abgehalten wird. Die Kommunikationswissenschaftlerin Kuba war ebenfalls bis 2007 Vorsitzende des Verbands Sozialistischer Studentinnen und Studenten und später Pressesprecherin in der Arbeiterkammer und von Finanzstaatssekretär Andreas Schieder (SPÖ). Beide Autorinnen traten aus Protest aus der Partei aus, weil die SPÖ, nachdem sie 2006 wieder zur Kanzlerpartei gewählt wurde, ihr Versprechen, die Studiengebühren abzuschaffen, nicht einhielt.
Also wieder zwei Frauen, die uns das, was Alice Schwarzer und viele andere seit der Veröffentlichung von "Der kleine Unterschied" im Jahr 1975 über die Unterdrückung der Frauenwelt durch die bösen Männer erzählt haben, in anderen Worten neu präsentieren?
"Das Ende der Krawattenpflicht" geht ein ordentliches Stück weiter. Blaha und Kuba haben sich die Mühe gemacht, das Thema wissenschaftlich anzugehen. Ihre Darstellungen und Erklärungsansätze sind mit Verweisen auf eine Vielzahl an wissenschaftlichen Studien belegt und lassen kaum einen Bereich des menschlichen Lebens aus. Da wird von den Oscars eine Verbindung zu den spärlich gesäten Bürgermeisterinnen in der österreichischen Provinz gezogen, da trifft Angela Merkel auf 4 Non Blondes.
Den Antworten auf die Frage nach der fehlenden weiblichen Repräsentanz in der Politik spüren die beiden Autorinnen vom Tag der Geburt an nach. Sie zeigen auf, wie Geschlechterrollen erlernt werden, wie etwa zahlreiche Studien belegen, dass Erwachsene schon bei Säuglingen auf das idente Verhalten unterschiedlich reagieren, je nachdem, ob es sich um einen Buben handelt oder um ein Mädchen. Der Sprache wie auch der Körpersprache ist ebenfalls ein ganzes Kapitel gewidmet, von der Bedeutung der öffentlichen Rede, der Frage, wie meist höher klingende Frauenstimmen wahrgenommen werden, der Art, wie Politikerinnen sich kleiden, bis zu den unterschiedlichen Inszenierungen von Männern und Frauen. Da steht dann zum Beispiel der französische Präsident Nicolas Sarkozy für das Begrüßungsfoto mit Barack und Michelle Obama auf Zehenspitzen, während seine Frau Carla Bruni flache Ballerinas trägt und den Kopf nach vorne neigt, um noch ein Stück kleiner zu wirken.
Doppeltes Pech für Frauen
Überraschend ist auch die Analyse von Wahlkampfplakaten österreichischer Spitzenpolitikerinnen, die regelmäßig ein Bild schmückt: "Mit ganzem Herzen für Österreich" lautete im Bundespräsidentschaftswahlkampf 1998 der Slogan der Liberalen für ihre Kandidatin Heide Schmidt, "Mit ganzem Herzen für die Steiermark" warb die ÖVP-Politikerin Waltraud Klasnic im Landtagswahlkampf 2005, mit "Herz und Verstand" wollte Benita Ferrero-Waldner 2004 für die ÖVP Bundespräsidentin werden.
Analysiert wird aber nicht nur die Politik, sondern auch das Gegenüber: die Medien. So waren etwa im Jahr 1995 weltweit erst 17 Prozent aller Personen, über die Medien berichteten, weiblich, 2010 waren es bereits 24 Prozent. Hier zeigt sich also klar eine Veränderung. In der Politikberichterstattung ist das Verhältnis allerdings weniger ausgewogen. Während Männer eher bei den Hard News vors Mikrofon gebeten werden, ist der Anteil der befragten Politikerinnen im Jahr 2010 weltweit bei den Themen Wissenschaft und Gesundheit sowie Soziales am höchsten. Frauen in der Politik haben damit doppelt Pech: Erstens werden mit dieser Reduktion auf Softthemen Geschlechtermuster tradiert, und zweitens sitzen sie genau auf jenen Themen fest, für die es in der medialen Berichterstattung den geringsten Raum gibt. Während Kriminalität und Politik den meisten Sendeplatz einnehmen, werden Soziales und Wissenschaft in die Kurzmeldungen vor dem Wetterbericht hineingepresst.
Das Fazit fällt durchmischt aus. Die geringe Repräsentanz von Frauen in der Politik ist Resultat eines historischen Prozesses wie auch einer Arbeitsteilung. Gerade in jenen Jahren, in denen Männer in der Politik Karriere machen, kümmern sich Frauen um den Nachwuchs. Trotzdem bleibt am Ende die Hoffnung: Was Blaha und Kuba in ihrem Buch als Stolpersteine für Frauen anführen, sind nichts anderes als menschen- oder männergeschaffene Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden können.