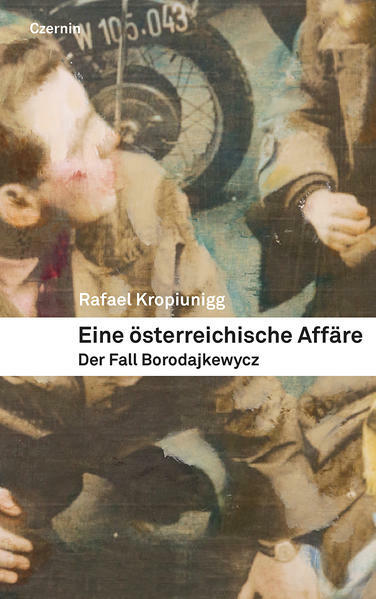Der Muff von tausend Jahren unter einem einzigen Talar
Ferdinand Lacina in FALTER 21/2015 vom 20.05.2015 (S. 19)
1965 offenbarte die Borodajkewycz-Affäre, wie antisemitisch Wiens Universitäten waren. Ein neues Buch– mit Schwächen – blickt zurück
Fünfzig Jahre später schreibt Rafael Kropiunigg über „eine österreichische Affäre“, den Fall Borodajkewycz. „Ich habe versucht, das Geschehen durch eine möglichst realitätsnahe, chronologische Nacherzählung zu rekonstruieren“, sagt er im Vorwort und bedient sich nicht nur der Veröffentlichungen in den Medien, sondern auch der Aussagen von Zeitzeugen. Als einer dieser, auch häufig zitierten Zeitzeugen habe ich bei der Lektüre neue Aspekte entdeckt, die das Lesen des Buches lohnend machen. Im Bemühen des Autors um Objektivität werden allerdings allzu viele Aussagen kommentarlos wiedergegeben. Insbesondere die von Günther Kümel, der, als er den Faustschlag gegen Ernst Kirchweger führte, schon auf eine rechtsradikale Karriere zurückblicken konnte, hätten eine gewissenhafte Prüfung auf ihren Wahrheitsgehalt verdient.
Nicht vorschnell verurteilen?
Abgesehen davon beschreibt Kropiunigg anschaulich das Mitte der 1960er-Jahre an der Hochschule für Welthandel – und anderen Fakultäten – herrschende Klima, das nicht nur durch ein zumindest distanziertes Verhältnis zur Demokratie, sondern auch durch das Ignorieren moderner Strömungen der Wissenschaft charakterisiert war. Die Regel der „Hausberufung“ spielte dabei eine wichtige Rolle. Durch sie wurden einem konservativ bis reaktionären Weltbild nicht entsprechende Kandidaten erst gar nicht zugelassen. Diese Praxis entstand übrigens nicht erst nach 1945. Die hohen Schulen Österreichs waren bereits in der Zwischenkriegszeit Zentren provinzieller Abschottung, die Vernunft wurde aus Österreich vertrieben, noch ehe es zur Ostmark geworden war.
Der Autor fordert die Leser auf, „Taras Borodajkewycz nicht vorschnell zu verurteilen: Er war ein Symptom“. Ja, das war er, aber nicht nur in seiner Weigerung, sich „an die neuen Realitäten Nachkriegsösterreichs anzupassen“. Er war auch ein Symptom für jene Charaktere, die problemlos ein Amalgam aus reaktionärem Katholizismus und deutschem Herrenmenschentum in sich vereinigten. Als Schüler von Heinrich Srbik war Borodajkewycz Archivar im Haus-, Hof- und Staatsarchiv, einer Zelle illegaler Nazis unter der Leitung von Ludwig Bittner, der bereits 1937 wegen seiner „entschlossenen anti-jüdischen Gesinnung“ das Lob der künftigen Herren der Ostmark und folgerichtig auch ein Ehrendoktorat der Universität Berlin erhielt. Borodajkewycz war gleichzeitig Mitglied einer CV-Verbindung, Sekretär des Katholikentages und seit 1933 illegales NSDAP-Mitglied sowie Mitarbeiter des NS-Nachrichtendienstes. Er schulte Angehöriger der SA und der SS, wurde 1940 Dozent an der Wiener und 1942 Professor an der Prager Universität.
Symptomatisch ist ebenfalls das schlechte Gedächtnis, eine Schwäche, die er mit Kurt Waldheim teilte. So meinte er in seiner Bewerbung als Universitätsprofessor im Jahre 1954, dass die Frage nach seinem Verhältnis zur NSDAP „überholt und unwichtig“ sei. Borodajkewycz war auch ein Symptom für die Situation an der Hochschule für Welthandel, wo der wissenschaftliche Pluralismus sich weitgehend auf konkurrierende autoritäre bis faschistische Weltbilder beschränkte.
Dieser Hintergrund zeigt, dass es nicht um „Lehr- und Lernfreiheit“ ging, auch nicht um eine Auseinandersetzung zwischen rechts und links. Kropiunigg versteigt sich einmal sogar zu der Bemerkung, dass das „linke Lager (…) die politische Rechte zerschlagen (wollte)“. Da ist der Autor weit entfernt von nüchterner Analyse und nimmt auch nicht zur Kenntnis, dass nicht nur „Linke“ gegen Borodajkewycz auftraten. Beispiele dafür sind der leider verstorbene Alfred Stirnemann, einer der Hauptbelastungszeugen gegen Borodajkewycz, der aus der Katholischen Hochschuljugend kam und später ÖVP-Vordenker wurde, und Reinhold Knoll, der bei der Trauerkundgebung für Kirchweger das Wort ergriff.
Der Autor vergleicht die Affäre um Borodajkewycz mit jener um Kurt Waldheim. Abgesehen davon, dass der eine selbst um Beurlaubung bat und dann in die Pension verabschiedet, der andere hingegen leider zum Bundespräsidenten gewählt wurde, ist auch die unterschiedliche internationale Aufmerksamkeit und die nachhaltige Wirkung der Affären auf den Bedeutungsunterschied der Funktionen beider Herren zurückzuführen. Immerhin, im Jahr 1965 wurde in Österreich ein erster Blick unter Talare geworfen, unter denen im Jahr 1968 oft zu Recht der Muff von tausend Jahren vermutet werden sollte.