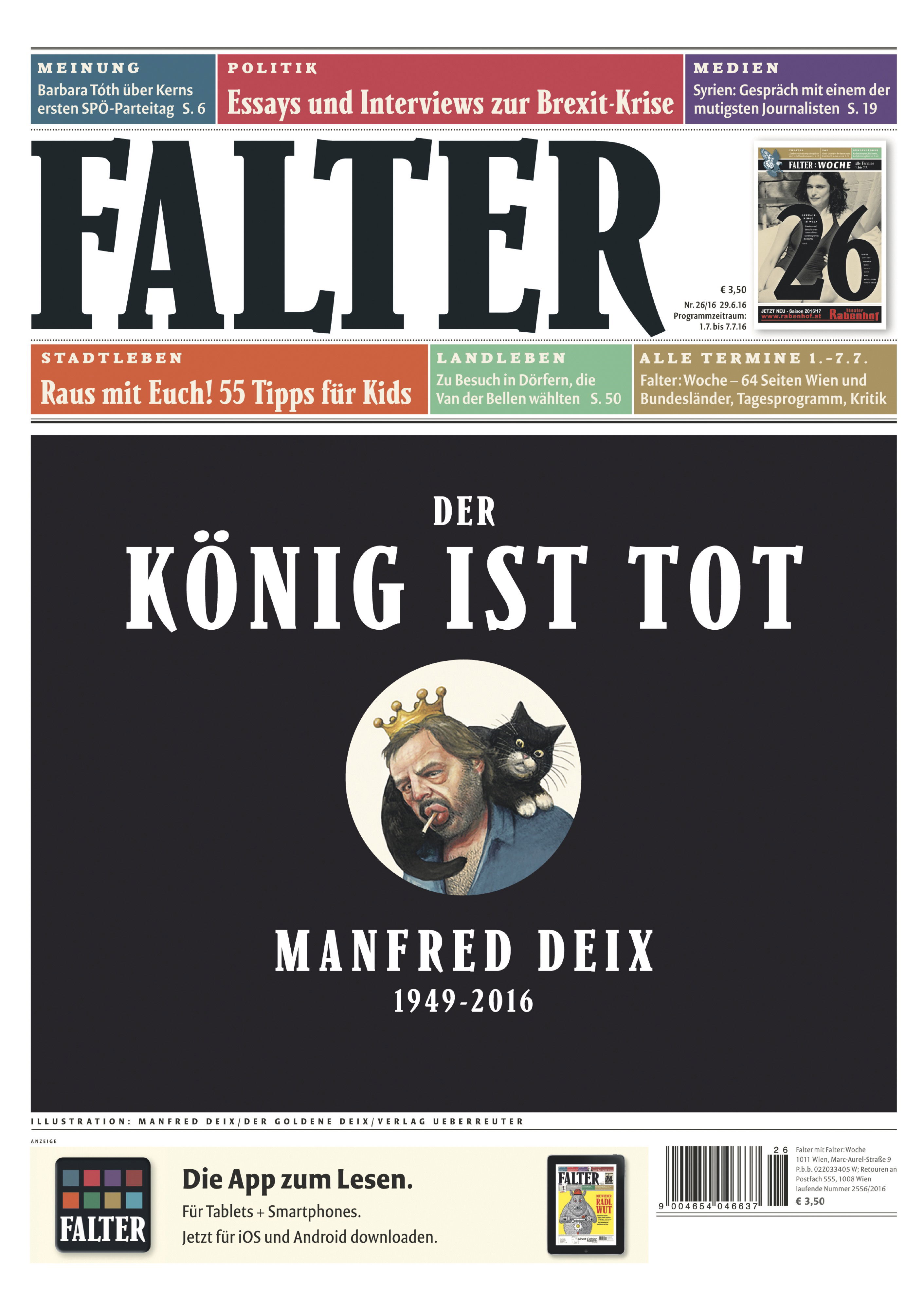
Das steirische Vorspiel des Nationalsozialismus
Siegfried Beer in FALTER 26/2016 vom 29.06.2016 (S. 16)
Warum gedieh der Deutschnationalismus in der Steiermark besonders gut? Ein neuer Sammelband liefert Antworten
Dass die Steiermark von jeher ein fruchtbarer Boden für den Deutschnationalismus und in den 1930ern eine Bastion insbesondere des erstarkenden Nationalsozialismus darstellte, ist nicht ganz unbekannt. Schließlich ist die steirische FPÖ der Deutschtümelei bis heute verbunden.
Warum das so war und in gewisser Weise immer noch ist, wurde bis vor kurzem wissenschaftlich kaum aufgearbeitet und analysiert. Erst im letzten Jahr erschienen zwei erhellende Bücher, die die NS-Zeit in der Steiermark neu beleuchten und einigermaßen kontextualisieren, darunter etwa „Nationalsozialismus in der Steiermark. Opfer. Täter. Gegner“, herausgegeben von Heimo Halbrainer und Gerold Lamprecht (Studienverlag Innsbruck), und „Geschichte der Steiermark. Bundesland und Reichsgau“, Band 9/1, herausgegeben von Alfred Ableitinger (Böhlau Wien).
Nach seinen Monografien über den Juliputsch 1934 in Österreich („Sommerfest mit Preisschießen“, 2006) und über die sogenannte Österreichische Legion („Söldner für den Anschluss“, 2011) hat der Wiener Historiker Hans Schafranek nun gemeinsam mit dem südsteirischen Regionalforscher Herbert Blatnik im Wiener Czernin-Verlag einen weiteren Band zu diesem Themenbereich herausgegeben: „Vom NS-Verbot zum ‚Anschluss‘. Steirische Nationalsozialisten 1933–1938“.
In dem dokumentarisch breit angelegten Werk zeichnen insgesamt sieben Autoren die organisations- und personalhistorische Entwicklung der illegalen steirischen NS-Bewegung in den entscheidenden Jahren 1933 bis 1938 penibel nach, was die allzu lang offene Forschungslücke in der österreichischen Zeitgeschichte einigermaßen schließt.
Natürlich nicht vollständig: Geschichtsforschung endet nie. Zwar ist diese Studie über weite Strecken der traditionellen, ereignisgeschichtlich orientierten Landesgeschichtsschreibung verpflichtet – eklatant bei den zwei Beiträgen des Mitherausgebers –, dennoch aber vermag sie die eine oder andere strukturelle Klärung steirischer Verhältnisse während der behandelten Fünfjahresspanne zu bieten.
Steirischer Heimatschutz
So kann Martin Moll überzeugend darlegen, dass der schon in den Nachwirren des Ersten Weltkrieges begründete, bürgerlich geprägte antisemitische Steirische Heimatschutz (HS) mit seinen 120.000 Mitgliedern wesentlich zum ideologischen Wegbereiter des steirischen Nationalsozialismus wurde, in dem er schlussendlich aufging.
Schlagende Burschenschaften und der Schulverein Südmark hatten diesen Boden jahrelang aufbereitet. Der Pfrimer-Putsch des Jahres 1931 war dann der erste, wenn auch stümperhafte, Versuch eines Umsturzes demokratischer Verhältnisse im Land. Ihm folgte 1932/33 eine propagandistische NS-Terror- und Anschlagswelle, die am 19. Juni 1933 zum Verbot der NSDAP und ihrer Teilorganisationen durch die autoritäre Regierung Dollfuß führte.
Eine bezirksbezogene Fallstudie von Gerald Wolf bricht die Phänomene dieses später als „Kampfzeit“ geführten Vorspiels zur Machtübernahme auf die kleinregionale und lokale Ebene in der Weststeiermark herunter.
Dem gerichtlichen Nachspiel des Juliputsches unter einer standrechtlichen Gesetzgebung im Militärgerichtshof des Ständestaates in Graz und Leoben und in den Volksgerichten nach 1945 ebendort bis 1951 geht Heimo Halbrainer nach. Wenngleich insgesamt 419 Juliputschisten von Sondergerichten teilweise zu hohen Kerkerstrafen verurteilt und zwei von fünf Todesurteilen auch vollstreckt wurden, so wurde kein einziger der wegen Mordes bzw. Mordversuchs angeklagten Juliputschisten vom Volksgericht der Zweiten Republik verurteilt.
Steirische Fememorde
Friedrich Brodtrager und Manfred Bauer arbeiten die These heraus, dass sich die Steiermark ob ihrer geopolitischen Randlage zum slawischen Nachbarn etwa in Beamtenschaft und Mittelstand schon früh als „Bollwerk der Deutschheit“ verstand und dass sich auch in den protestantischen Hochburgen der Obersteiermark „eine deutlich erhöhte Affinität“ zur NS-Ideologie herausbildete.
Das habe den Nährboden dafür geliefert, dass einerseits die NS-Bewegung in der Steiermark wesentlich schneller wuchs als anderswo und andererseits, aufmerksam beobachtet von angloamerikanischen Medienberichterstattern, aggressive Grenzlandnationalsozialisten in den Februar- und Märztagen 1938 in Graz sogar außenpolitisch relevante Handlungen zu setzen vermochten, so die kühne Interpretation.
Den wichtigsten Beitrag liefert Herausgeber Schafranek selbst mit einer Spezialstudie über Fememorde in der Steiermark, die er hauptsächlich aus deutschen NS-Quellen (Bundesarchiv in Berlin) als solche herausarbeiten konnte. Insgesamt sind zwischen Juni 1933 und März 1938 „durch Nationalsozialisten in Österreich 169 Personen getötet und 624 verletzt“ worden, (…) 145 Todesopfer (…) bis Juli 1934“ (S. 346). Der besonders niederträchtige Typus Fememord wird an mehreren steirischen Fallbeispielen expliziert. Und kein einziger dieser Fememörder konnte in Österreich nach 1933 verhaftet werden.
Abbildungen, Tabellen und Fotos lockern eine nicht immer leicht lesbare Lektüre auf. 36 biografische Skizzen zu den wichtigsten illegalen NS-Funktionären aus der Steiermark beschließen den Sammelband, dessen Einführung etwas zu knapp ausgefallen ist. Eine analytische Zusammenfassung fehlt leider ganz. Alles in allem dennoch ein wichtiger Beitrag zum besseren Verständnis dafür, wieso die steirischen Nationalsozialisten relativ leicht und so erfolgreich dazu beitragen konnten, den Ständestaat zu unterminieren und schließlich zu stürzen.



