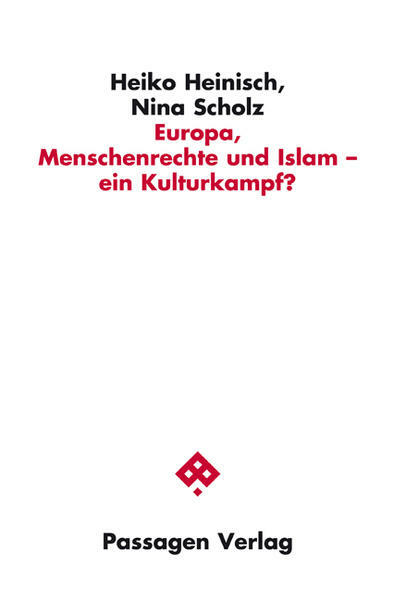Islam: raus aus dem Dschungel der Reizwörter
Veronika Seyr in FALTER 40/2012 vom 03.10.2012 (S. 17)
Zwei junge Wiener Politikwissenschaftler haben eine Studie über den Islam und Europa verfasst – eine geradezu heilsame Lektüre
Manche Bücher führen aus der Orientierungslosigkeit heraus, die im Dschungel der Reizwörter entsteht – zum Beispiel Multikulturalismus, Toleranz und Integration. So wie dieses Buch zweier junger, in Wien tätiger Politikwissenschaftler mit deutschem "Migrationshintergrund".
Im Lichte der Aufregungen um Anti-Mohammed-Video oder Kopftuchdebatte wirkt das Buch von Heiko Heinisch und Nina Scholz geradezu wie eine Eisdusche. Europas Gesellschaften, so die Ausgangslage, haben nach langen Kriegen zu einem religiösen Frieden gefunden, von dem die islamischen Gesellschaften weit entfernt sind. Die Terroranschläge von 9/11 haben die Frage der Vereinbarkeit von Religion – in diesem Falle Islam – und Demokratie wieder in den Vordergrund gerückt. Damit ging viel Begriffsverwirrung einher, wie die Autoren feststellen.
So lehnen sie den Ausdruck "Islamophobie" ab. Die Angst vor einem Gegenstand wie einer Spinne oder engem Raum sei nicht übertragbar auf einen wertebezogenen Gegenstand wie eine Religion. Heinisch und Scholz verwenden stattdessen den Begriff "Muslimfeindschaft", weil die Thematik mit dem Instrumentarium des Grundgesetzes und der Menschenrechte debattiert werden muss.
Die Autoren legen den Fokus auf die Ideengeschichte der Freiheitsrechte des Einzelnen. Damit vollziehen sie einen heilsamen Paradigmenwechsel von pro oder kontra Islam zu pro oder kontra Menschenrechte.
Die Konfrontation spielt sich ab zwischen individualistischen Gesellschaften, die durch die Grundrechte abgesichert sind, und traditionell kollektivistisch geprägten Strukturen der islamischen Zuwanderer. Entlang dieser Messlatte untersuchen die Autoren die Integrations- und Islam-Debatte in Europa. Am Ende der Kapitel finden Leserinnen und Leser jeweils eine Auswahl weiterführender Literatur.
Die ruhig vorgetragene Studie erklärt die Begriffsgeschichte des Multikulturalismus und unterscheidet zwischen multikultureller Gesellschaft und Kulturrelativismus. "Islam und Europa" – diese brisante Kontroverse verstehen die Autoren als Auseinandersetzung zwischen jenen, die für die Ideen der Moderne stehen, und jenen, die religiöse und kulturelle Kollektive in westlichen Gesellschaften einzementieren wollen.